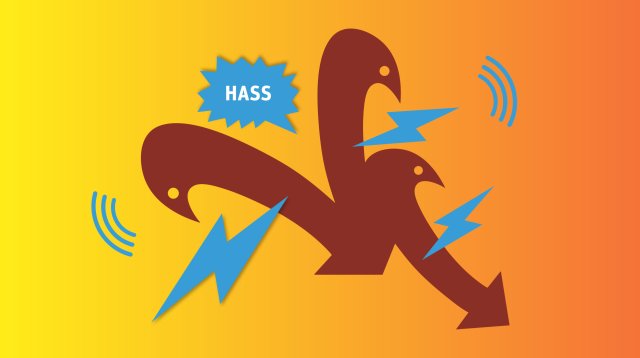Alex Struwe
Alex Struwe ist Redakteur für Geistes- und Sozialwissenschaften bei nd.Die Woche. Er ist Politischer Theoretiker und arbeitet zu Fragen und Begriffen kritischer Gesellschaftstheorie, Ideologiekritik, Autoritarismus oder Populismus. In zahlreichen Rezensionen kritisiert er den gegenwärtigen Wissenschaftsbetrieb und als Essayist und Kulturkritiker schreibt er über gebrochene Versprechen der Popkultur, Videospiele, Christopher Nolan-Filme oder Reality-TV.
Folgen:
Aktuelle Beiträge von Alex Struwe: