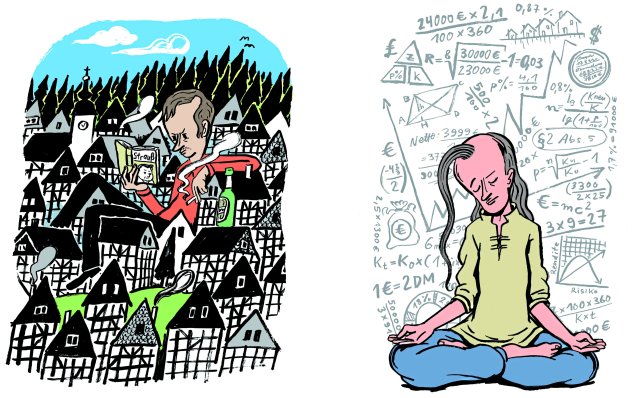- Kultur
- Godzilla und die Atombombe
Ein kapitalistisches Monster
In der Riesenechse Godzilla verarbeitete Japan Kriegstrauma und die Atombombenabwürfe. Bis heute ist das Monster Projektion von Angst und Allmacht

Vor 80 Jahren, am 6. und 9. August 1945, warf das US-Militär Atombomben auf die japanischen Großstädte Hiroshima und Nagasaki ab. Die Detonationen markierten das Ende des Zweiten Weltkriegs auch im asiatischen Raum. Mit hunderttausenden Toten wurden sie zugleich zum Sinnbild des Schreckens eines atomaren Krieges, der weit ins 20. Jahrhundert fortwirkte. Die atomare Zuspitzung der Dialektik der Aufklärung ging ins kollektive Bewusstsein über: Im Westen wurde die Bombe vor allem zum Symbol der destruktiven Potentiale technischen Fortschritts, in Japan wurde sie zum Trauma.
Als im März 1954 die Besatzung des japanisches Fischerboots »Glücklicher Drache V« dem Fallout der US-Atomwaffentests auf dem Bikini-Atoll zum Opfer fiel, kehrte jenes Trauma ins öffentliche Bewusstsein Japans zurück und fand eine popkulturell folgenreiche Manifestation: eine gigantische Monsterechse, die aus dem Meer stieg und die Zivilisation zerstörte. Godzilla gilt gemeinhin als kulturelle Verarbeitung der Atombombenabwürfe, entsprechend als Verkörperung eines unvorstellbaren Bösen, das über die japanische Gesellschaft hereinbrach. Zugleich begründete Godzilla das Genre des Kaiju-, also des Riesenmonster-Films und wurde zum langlebigsten Filmfranchise überhaupt, dessen Adaptionen bis zum letzten Film »Godzilla x Kong« 2024 reichen. Nimmt man die These ernst, dass Godzilla im Kern gesellschaftliche Traumabearbeitung darstellt, so sind die zahlreichen Umdeutungen und Neuerfindungen der Figur und ihre Symptomatik bis heute vielsagend.
Zerstörer und Beschützer
Acht Monate nach dem Bootsvorfall lief 1954 in Japan der erste Godzilla-Film, der unmittelbar zu einem Kassenschlager wurde. In ihm wird das brüllende Monster, dessen Name eine Kombination aus den Wörtern für Gorilla und Wal darstellt, von Atombombenversuchen aus einem uralten Schlaf geweckt und verwüstet daraufhin Tokio mit atomarem Hitzestrahl. Es ist das pure Böse, das unter großem Opfer besiegt werden muss, um die stolze japanische – und immerhin postfaschistische – Nationalseele zu heilen. Godzilla ist eine feindliche Gewalt, deren Übermacht durch Größe und atomaren Atem die deutlichen Spuren jener Kriegsgegner aus dem Westen trug, mit denen man sich aber als Weltkriegsverlierer in der Aussöhnung und wirtschaftlichen Annäherung befand. Zu dieser Annäherung gehörte ein Kulturtransfer, etwa wurde der Massenerfolg Godzilla auch in einer amerikanischen Kinofassung aufgeführt, allerdings so geschnitten, dass keine Bilder der zerstörten japanischen Städte Kritik am US-Vorgehen aufkommen lassen könnten.
Vereinnahmt von der amerikanischen Kulturindustrie erfuhr Godzilla in den folgenden Jahren und mehreren Fortsetzungen eine zentrale Umdeutung im japanischen Kino: von der katastrophalen Bedrohung wurde er zum Nationalsymbol und Retter. Die ersten 15 Filme der sogenannten Showa-Staffel bis 1975 reflektieren auf diese Weise die ambivalente Nationalgeschichte zwischen dem Ende des japanischen Imperialismus mit der Niederlage im Zweiten Weltkrieg, die der Kaiser dem Volk nach dem Atombombenabwurf verkündete, sowie dem enormen »Wirtschaftswunder« der Nachkriegszeit. Musste sich das japanische »Volk« der Übermacht Godzillas unterwerfen, so stand dieser bald im Kampf gegen andere Monster bei, gegen dreiköpfige Drachen, Tiefseeungeheuer, Riesenkrebs, Riesenmotte oder den Affen King Kong. Die Unterlegenheit des damaligen Kaiserimperialismus im modernen kapitalistischen Herrschaftsgefüge wird in der Überidentifikation mit der Wirtschaftsleistung kompensiert, als Ersatz des gebrochenen Nationalstolzes – ein Mechanismus, der den Deutschen allzu bekannt vorkommen mag.
Die Ambivalenz dieser Beziehung zur abstrakten Herrschaft zeigt sich in der Figur Godzillas selbst, die zwar beschützend, aber nicht minder bedrohlich auftritt und jeder seiner Kämpfe eine Spur der Verwüstung nach sich zieht. Von Anfang an ist diese Zerstörung genreprägend für den Monsterfilm gewesen: Städte werden dem Erdboden gleichgemacht, Brücken eingerissen, Strommasten entwurzelt. Das Ressentiment gegen die Zivilisation und das Unbehagen der modernen Gesellschaft wird hier vom uralten Naturwesen ausgelebt. Bis heute liegt eine verbotene Lust darin, die Wolkenkratzer unter den Tritten und Schlägen solcher Megawesen einstürzen zu sehen. Zugleich aber kämpfte Godzilla auch als Stellvertreter in gesellschaftlichen Großkonflikten gegen Monster, die aus Umweltverschmutzung, Invasion oder Biotechnologie hervorgingen.
Demut vor dem Urzeitmonster
Godzilla vereint damit ambivalente Gefühle von Ohnmacht, Angst, Rache oder Zerstörungswut und kanalisiert sie in eine, man kann sagen, klassische moderne Herrschaftsformel: Demut. Gegen den (atomaren) Größenwahn der Menschheit helfe nur eine Rückbesinnung auf mystische vorzivilisatorische Kräfte und ihre natürliche Ordnung. Und darin liegt die große autoritäre Verheißung, denn wenn man sich diesen Mächten unterwirft, gewinne man erst wahre Stärke. Diese Idee zieht sich durch die weitere Entwicklung der Godzilla-Filme und taucht in abgewandelter Form auch in den späten US-amerikanischen Verfilmungen zum Millennium hin auf.
1998 nahm sich Roland Emmerich in der ersten Hollywood-Inszenierung des Stoffes an. Sein »Godzilla« wurde von den Kritiken zerrissen und unter Fans als GINO verspottet – ein Akronym aus »Godzilla In Name Only«, also Godzilla nur dem Namen nach. Das Monster wird hier als mutierte Echse fantasiert, die aus französischen (!) Atombombentests im Pazifik hervorging. Im Laufe des Films entpuppt sich der Mutant aber trotzdem als Naturkreatur, nämlich als sorgende Mutter, die lediglich unter dem Madison Square Garden in New York nach Lebensraum und Schutz für ihren Nachwuchs sucht.
Die wesentlich erfolgreichere Verfilmung aus der sogenannten MonsterVerse-Reihe, die mit Gareth Edwards’ »Godzilla« 2014 begann und bis nach Japan positiv rezipiert wurde, knüpft wieder an Godzilla als einem prähistorischen Naturwesen an. In dieser Version haben die US-Atomtests der 1950er – die bereits Versuche waren, das Urzeitmonster Godzilla zu töten – dummerweise noch andere Wesen aus dem Erdinneren geweckt. Jene atomaren Parasiten richten nun auf ihrer Nahrungssuche weltweit verheerende Verwüstungen an. Die Menschheit stößt hier an ihre Grenzen, denn diese atomaren Parasiten lassen sich nicht mit den Atomwaffen bekämpfen, die aber als einzige genug Kraft gegen die Riesen hätten. Wie bereits im ersten Godzilla-Film von 1954 verkörpert der Wissenschaftler Ishiro Serizawa (Ken Watanabe) das Dilemma: Um den befehlshabenden Admiral vom aussichtslosen Atomschlag abzuhalten, mahnt der Forscher mit der Uhr seines Vaters, die am Morgen des 6. August 1945 stehengeblieben war. »Die Arroganz des Menschen besteht darin, dass er glaubt, die Natur unter seiner Kontrolle zu haben«, referiert Serizawa. »Die Natur hat eine Ordnung, eine Kraft, die das Gleichgewicht wiederherstellt«. Godzilla »ist diese Kraft«. Und so bleibt den Menschen nichts anderes übrig, als Godzilla gegen die Monster kämpfen zu lassen.
Die Naturalisierung des Kapitalismus
Wo der Mensch die Natur aus dem Gleichgewicht gebracht hat und diese selbst nun – hochgradig destruktiv – zur Harmonie zurückfinden soll, werden die Menschen konsequenterweise zu Zuschauenden degradiert. Als Hilflose sehen sie den Ereignissen zu, die schon längst nicht mehr ihre Geschichte im eigentlichen Sinne sind, sondern von Mächten bestimmt, die ihnen über den Kopf gewachsen sind. Zugleich sind sie darin unbedeutend geworden, wie die holzschnittartigen Charaktere der Filme aus dem MonsterVerse, die in zahlreichen Kritiken bemängelt wurden.
Das Motiv einer Naturkraft, die die menschlichen Exzesse ausgleichen soll, findet sich zu dieser Zeit vermehrt auch in Filmen wie »Jurassic World« von 2015. Hier sind es genmutierte Dinosaurier, die aus Profitgier gezüchtet wurden, gegen die nur noch der echte Tyrannosaurus Rex helfen kann. Der perverse Exzess wird durch eine Rückkehr zum gesunden Maß reguliert – eine Vorstellung, die vor allem eine verzögerte Antwort auf die globale Finanzkrise im entfesselten »Raubtierkapitalismus« sein dürfte.
Hinter dem Kulturpessimismus, der vermeintlich zur natürlichen Ordnung zurückwill, steckt jedoch bloß die Naturalisierung des Kapitalismus. Der angestrebte Ausgleich ist nicht die Überwindung jener Verhältnisse, die in Zerstörung, Krieg und Atomtod führten, sondern die Rückkehr dorthin, wo die (kapitalistische) Welt noch in Ordnung schien. Diese Ideologie des gemäßigten Kapitalismus ist nichts als billige Versöhnung mit den destruktiven Verhältnissen: nicht nur, weil darin der eigentliche Schrecken – um im Bild zu bleiben, der Angriff einer monströsen Riesenechse – kurzerhand zur Lösung statt zum Problem verkehrt wird. Vielmehr ebnet der Kapitalismus als vermeintlicher Naturzustand der Regression Tür und Tor, wie der letzte japanische Godzilla-Film der sogenannten Reiwa-Staffel, »Godzilla Minus One« von 2023, eindrucksvoll zeigt.
International gefeiert wurde der oscarprämierte Film vor allem für seine packende Handlung, die im Gegensatz zu den Hollywood-Produktionen Charaktere mit Tiefgang und eine echte Aufarbeitung der japanischen Kriegstraumata bieten würde. Im Grunde wird hier aber ein nationalistisches Heldenepos aus dem Bilderbuch erzählt, das hervorragend auf dem metaphysischen Gut-Böse-Konflikt gedeiht, zu dem Godzilla über die Jahrzehnte gemacht worden ist. Im Mittelpunkt der Handlung steht der desertierte Kamikaze-Pilot Kōichi Shikishima (Ryūnosuke Kamiki), dessen »Feigheit«, sich nicht im Selbstmordangriff für den japanischen Krieg geopfert zu haben, Godzilla bei einem Angriff auf eine Militärbasis entkommen ließ. Shikishima lebt daraufhin jahrelang mit der »Schande«, durchlebt den japanischen Wirtschaftsaufschwung, aber die heile Welt wird von Godzillas Angriffen heimgesucht. Nur sein Opfer in einem finalen Selbstmordangriff kann das Trauma beenden.
Natürlich hat der Film ein Happy End, inklusive des Ausblickes auf eine ewige Wiederholung des Kampfes gegen das Böse. Godzilla wird hier wieder zum Feind erklärt, aber zu einem innerlichen. Diese Umdeutung ist zugleich eine Art Rückkehr zu den Wurzeln, sie trägt aber auch die Zeichen einer Zeit der Regression, der kriegerischen Weltmarktkonkurrenz und erstarkenden Nationalismen. Bei all dem darf nicht vergessen werden: Das Monster, das die Welt seit nunmehr 80 Jahren in wechselnden Formen heimsucht, haben wir selbst geschaffen.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.