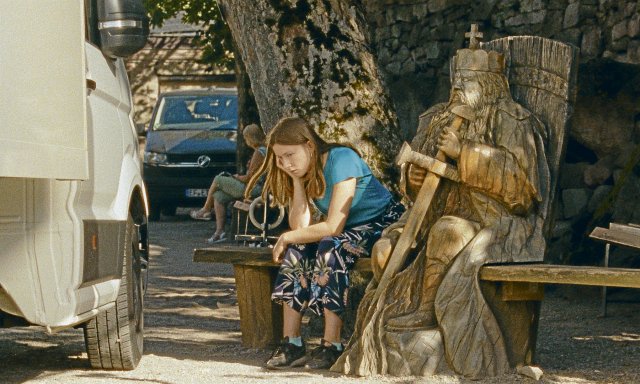- Kultur
- Rechte Influencer
Werbung für Faschismus
Rechte Inhalte boomen in den sozialen Medien und bei jungen Leuten. Das Erfolgsrezept autoritärer Agitation ist dabei älter als die Digitalisierung
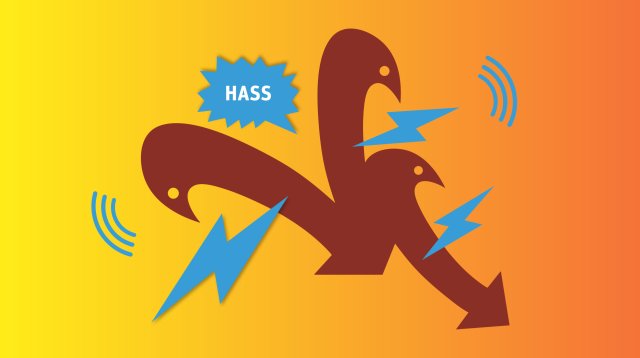
»Hass und Hetze« sind nicht erst im digitalen Zeitalter ein Erfolgsmodell. Bereits in den 1940er Jahren analysierte der in die USA immigrierte Soziologe Leo Löwenthal die faschistischen Hassprediger in seiner Studie »Falsche Propheten«. Deren Anziehungskraft auch für liberale Demokraten erklärte er durch die spezifische Bearbeitung dessen, was er Unbehagen nannte: ein »Grundzustand des modernen Lebens«, der sich etwa im Gefühl zeige, betrogen oder zum Verlierer geworden zu sein. Zur Linderung dieses Leidens biete der Agitator die Vorstellung an, die Profiteure hätten sich zu einer Verschwörung zusammengetan, die sie hinter liberalen Ideen und Institutionen vertuschen. Wo vorher Ohnmacht war, wird Aggression geschürt: gegen übermächtige Feinde, gegen den korrupten Staat und seine »Elite«, die dann an den hilflosen Feinden wie Geflüchteten oder »Parasiten« ausgelebt werde.
Weil der Agitator mit dem Unbehagen erfolgreich Stimmung macht, habe er nicht vor, etwas gegen die gesellschaftliche Krise zu tun. »Im Gegenteil«, schreibt Löwenthal, er »trachtet danach, sie zu vertiefen bis zu einem Punkt, wo sie sich zu einer paranoiden Beziehung zur Außenwelt verdichtet. Und wenn sein Publikum diesen Punkt erreicht hat, ist es reif für seine Manipulation.« Der Kern des Geschäfts faschistischer Werbetrommelei ist also die Aktivierung des Einzelnen, und zwar zur Gefolgschaft, die eine Überwindung der Ohnmacht gerade durch Unterwerfung verspricht. Die Erfolgsbedingungen für dieses Rezept könnten im digitalen Zeitalter kaum besser sein: Die Gegenwart scheint krisengeschüttelter denn je und die Menschen sind vernetzt und vereinzelt zugleich.
Einfluss im vorpolitischen Raum
Es ist daher kaum verwunderlich, dass rechte Kräfte von dieser Konstellation profitieren wollen – und dabei Erfolg haben. Das Umfragehoch der AfD und ihre Erfolge im letzten Bundestagswahlkampf wurden vielfach mit deren Präsenz in den sozialen Medien in Zusammenhang gebracht. Demokratische Parteien übernehmen offen rechte Forderungen wie etwa nach »Migrationskontrolle«. Die Grenzen des Sagbaren sind längst nach rechts verschoben, so auch und vor allem im Netz.
Dies bildet die diskursive Grundlage dafür, dass rechte Straf- und Gewalttaten laut Innenministerium im letzten Jahr um 48 Prozent zugenommen haben. An Schulen schlagen Lehrkräfte und Beratungsstellen Alarm, dass sie dem »Sturm, der sich zusammengebraut hat«, nicht mehr Herr werden, wie etwa jüngst der »NDR« zu Mecklenburg-Vorpommern berichtete. Im Zentrum dieser Befunde zur rechten Gesinnung unter jungen Menschen stehen immer wieder die sozialen Medien. Gezielt machen sich rechte Gruppen die digitale Infrastruktur von Youtube, über Instagram und Tiktok bis zum Messengerdienst Telegram zunutze, um einerseits Themen und Begriffe wie »Remigration« aktiv in der Online-Öffentlichkeit zu tragen, aber auch um neue Mitglieder zu rekrutieren.
Die Jugendorganisation der NPD-Nachfolgepartei Die Heimat, Junge Nationalisten (JN), setzt etwa neben zahlreichen Neugründungen sogenannter Revolte-Ortsgruppen auch auf dezentrale »Tiktok-Divisionen«, wie ein Digital-Report des Else-Frenkel-Brunswik-Instituts (EFBI) in Leipzig festhielt. Diese Gruppen würden »eine ausgeklügelte Social-Media-Strategie verfolgen, indem sie jugendaffine Ästhetiken wie Bomberjacken, Sneakers, Springerstiefel oder Fashwave-Optiken nutzen und Themen wie Migration mit Identitäts- und Selbstaufwertungsangeboten kombinieren«, schreibt Alexander Ritzmann vom Counter Extremism Project (CEP).
Der Erfolg rührt weniger von der Verführung durch digitale Rattenfänger. Er liegt in der Logik des Influencermarketings.
Besonders die Kurzvideoplattform Tiktok biete Rechten eine digitale Reichweite, heißt es im EFBI-Report. Der spezifische Algorithmus spielt Videos nach thematischen Präferenzen an die Nutzenden aus und ermöglicht es zudem, dass erfolgreiche Videos durch leichte Variationen kopiert und weiter verbreitet werden können. Die enorme Präsenz der AfD auf der Plattform, etwa im Zuge der Landtagswahlen 2024 und der letzten Bundestagswahl, sei daher auch durch den Einsatz einer »Tiktok-Guerilla« möglich geworden, die massenhaft Videos mit Bezug zur AfD hochgeladen hatte.
Jedoch sind solche dezidiert »rechten Influencer«, die Demonstrationen begleiten oder Propagandavideos zu Nationalstolz und rassistischer Hetze zusammenschneiden, nur die Spitze des Eisbergs. Zwar besteht die »metapolitische« Strategie der Neuen Rechten darin, den vorpolitischen Raum und damit auch die sozialen Medien zu besetzen. Aber der eigentliche Erfolg rechter Inhalte rührt weniger von den auswendig gelernten Ansprachen junger Neonazis in Online-Videos oder von der Verführung durch digitale Rattenfänger. Die Anschlussfähigkeit liegt in der Logik des Influencermarketings.
Einstiegsdroge »Lügenpresse«
Das Bindeglied zwischen explizit rechten Inhalten und den sozialen Medien ist die Verschwörungserzählung. Deren Beliebtheit folgt wiederum dem klassischen Rezept der Bearbeitung des Unbehagens: Irgendetwas da draußen stimmt nicht, die Politiker sind korrupt und finstere Machenschaften lauern. Eines der bevorzugten Motive ist hierbei die »Lügenpresse«, gewissermaßen die Einstiegsdroge in das Verschwörungsdenken. Denn damit wird die banale Feststellung, dass jeder Bericht über die Wirklichkeit eine Spur von Interessen beinhaltet, zur Annahme einer kontrollierten und von oben gesteuerten Lüge umgedeutet. Wer diese Lüge anklagt, kann sich als vermeintlich ehrlich darstellen: Immerhin sage man, wie es ist, und zeige Haltung, so die Botschaft. Die liberalen Eliten hingegen würden ihre eigenen Interessen als universelle Werte behaupten.
So bewarb sich etwa der damalige Tiktok-Star der AfD und mittlerweile Bundestagsmitglied, Maximilian Krah, in einem seiner Videos: »Du willst dich über Politik informieren? Bloß nicht bei ARD und ZDF. Sei selber schlau. Schau dir gute Youtube-Kanäle an und meine Tiktoks.« Der Politiker empfahl jungen Männern, keine Pornos zu schauen sowie nicht »lieb, soft, schwach und links zu sein«. Statt allzu offener Hetze bediente Krah lediglich die Mechanismen des Influencermarketings: Nahbare und vermeintlich authentische Persönlichkeiten geben in direkter Ansprache ihre Tipps zu Schönheits- oder Fitnessroutinen, Anlagestrategien oder Produkten. Auch beim Raunen über »die da oben« und ihre kontrollierten »Systemmedien« kommt es dann nicht darauf an, dass man selbst die Wahrheit sagt, sondern nur darauf, dass im Wettbewerb der Ideen niemand mehr die Wahrheit sagen kann.
Hass zwischen Krypto und Fitness
Auf dem digitalen Marktplatz der Ideen kommt es so immer mehr zu Überschneidungen zwischen beliebten Lifestyle-Themen wie Fitness, Ernährung oder »finanzieller Unabhängigkeit« und rechter Ideologie. Dafür müssen Rechte diese Themen nicht einmal kapern, wie etwa durch Kampfsport-Content oder soldatische Einstellungen zu Sport und Körper. Denn im Grunde funktioniert die faschistische Propaganda nach den Regeln der Werbebotschaften – und Werbung ist im digitalen Raum universell geworden.
Diese Verbindung zeigte sich etwa bei sogenannten Finfluencern, also Influencern mit Finanz- und Anlagestrategien. Meist präsentieren diese einen extravaganten Lebensstil, beispielsweise in Dubai, den sie angeblich durch clevere Investitionen erreicht haben. Damit man es ihnen gleichtun könne, werben sie mit Geheimwissen über Marktbewegungen oder prophezeien den nächsten Crash.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Im vergangenen Jahr sorgten die Podcaster Kiarash Hossainpour und Philip Hopf für einen mittleren Skandal, da sie mit »Hoss & Hopf«, dem damals erfolgreichsten Podcast Deutschlands, Themen behandelten wie »Werden wir von einem versteckten System kontrolliert?« oder »Die mächtige Familie Rothschild und ihre Werte«. Ausschnitte der Finfluencer wurden massenhaft auf Tiktok geteilt, ebenso deren Übergang von libertären Finanzgurus zum rechten Verschwörungsgeraune. Ihre Botschaft lautet: Wer die richtigen Anlagestrategien verfolgt, das Gewinner-Mindset hat, seinen Körper fit und die Seele rein hält und sich nicht von der Gehirnwäsche zum Verlierer machen lässt, der kann die finanzielle Unabhängigkeit und ein Jetset-Leben erringen.
Die Verheißung der Unabhängigkeit wiederholt auf der individuellen Ebene, was Rechten als Souveränität für »ihr Land« vorschwebt: eine Selbstbestimmung, die gerade dadurch erreicht werden soll, dass man sich der höheren oder natürlichen Ordnung unterwirft: Deutschland den Deutschen, Männer sollen wieder Männer sein und Frauen sogenannte Tradwives. Der Finanzmarkt, dem die Libertären huldigen, ist dabei eine ideale Projektionsfläche. Er lenkt die Geschicke des globalen Kapitalismus, und zwar auf eine hochgradig irrationale und kaum zu durchschauende Weise. Mit dem Geheimwissen, das sich durch die parasoziale Bindung an die Erfolgsvorbilder erreichen lasse, könne man doch wieder sein Schicksal selbst in die Hand nehmen.
Dieselbe Struktur liegt den Botschaften der neuen MAHA-Bewegung (Make America Healthy Again) in den USA zugrunde: Gegen die vermeintliche Macht der großen Konzerne, die die Menschen mit Lebensmittelzusätzen vergiften würden, werben verschiedenste Influencer – unter der Schirmherrschaft des Gesundheitsministers Robert F. Kennedy Jr. – für neue Diäten, Rohmilch, gegen Impfungen und natürlich für ihre jeweiligen Produktreihen. Statt von der ominösen Konzernmafia kontrolliert zu werden, versprechen die Ernährungstipps, die Kontrolle über sich und das ganze Leben zurückzugewinnen.
Darin liegt die zentrale Werbebotschaft gegen das Unbehagen und die Ohnmacht in der gegenwärtigen Krisensituation. Und dieses Leiden lässt sich mit Schönheitstipps oder der richtigen Fitnessroutine ebenso lindern wie mit der Fantasie, den finsteren Machenschaften von Umvolkung bis Zwangsimpfungen wieder die Stärke des »wahren Volkes« entgegensetzen zu können. Denn es spielt kaum eine Rolle, was erzählt und womit den Leuten Trost über ihren gefühlten Souveränitätsverlust gespendet wird. Es zählt einzig der Erfolg – und dies haben Faschismus und der Algorithmus gemeinsam.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.