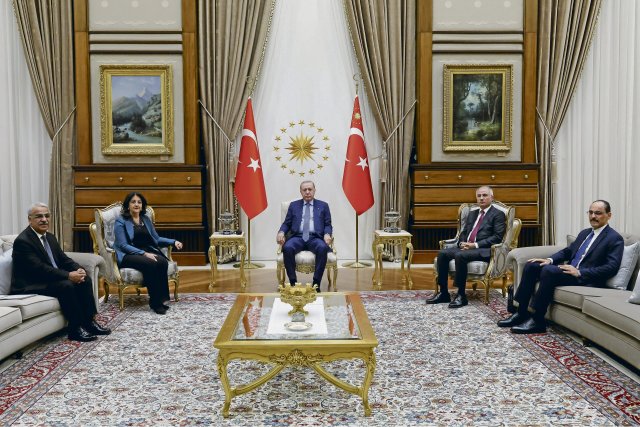Russische Wechsel auf die Zukunft
Moskau beginnt mit der größten Privatisierung von Staatseigentum der letzten Jahre
Die Ölgiganten Rosneft und Baschneft, der Durchleitungskonzern Transneft, die russischen Staatsbahnen RZD, der Diamantenförderer Alrosa, die Fluggesellschaft Aeroflot und der Telekommunikationsriese Rostelekom: Das ist Russlands Tafelsilber, das in Kürze bei der größten Privatisierung von Staatsunternehmen der letzten Jahre unter den Hammer kommen soll.
Finanzminister Anton Siluanow will damit im laufenden und im kommenden Jahr mehr als eine Billion Rubel erlösen. Das sind aktuell 11,2 Milliarden Euro. Allein der Verkauf von 19,5 Prozent der Rosneft-Anteile soll 7,15 Milliarden US-Dollar in die Kassen spülen. Wirtschaftsminister Alexei Uljukajew kann sich sogar die Privatisierung staatlicher Geldhäuser - darunter Branchenprimus WTB - vorstellen. Nur die Sberbank soll staatlich bleiben. Dort oder unter der Matratze hortet die Bevölkerung ihren Notgroschen und die wolle, so Zentralbankchefin Elvira Nabiullina, in turbulenten Zeiten Sicherheit.
Turbulenzen waren der Hauptgrund für die immer neue Verschiebung der seit Jahren geplanten Verkäufe: zuerst die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise und deren Nachbeben, dann Stagnation und schließlich Rezession. Die Ölpreise stürzten ab, rissen die Rubel und die Kurse börsennotierter russischer Unternehmen mit.
Doch länger warten können Moskaus Kassenwarte nicht. Im September wird das Parlament gewählt, Anfang 2018 der Präsident. Die eiserne Reserve aber, mit der der Kreml den Gesellschaftsvertrag mit Souverän Volk finanziert - bescheidener Wohlstand gegen politisches Wohlverhalten - schmilzt wie Butter in der Sonne.
Finanzminister Siluanow hat sich daher ein sehr trickreiches »Schema« für die Privatisierung einfallen lassen. Die Investoren sollen statt Aktien Wechsel bekommen. Die können sie erst nach ein paar Jahren in Anteilscheine umtauschen. Steigende Ölpreise, so die Begründung, seien unvermeidlich, dadurch werde »automatisch« auch der Wert der Unternehmen steigen. Die Obligationen sind daher nicht auf der Basis des derzeit niedrigen, sondern des angenommenen höheren Marktwertes kalkuliert,
Der Wechsel auf die Zukunft ist indes höchst riskant. Niemand wagt momentan Prognosen wie die russische Wirtschaft sich kurzfristig entwickelt, geschweige denn langfristig. Investoren, darunter auch ausländische, hoffen Politiker und staatsnahe Wirtschaftsweise, werden dennoch Schlange stehen. Vor allem dann, wenn Beteiligungen einen Sitz in Aufsichtsrat garantieren.
Die Börsen, so auch Finanzexperte Alexander Ossin, würden die russische Wirtschaft seit etwa anderthalb Jahren »verzerrt abbilden«. Vor allem Staatskonzerne seien unterbewertet. Wer jetzt Anteile erwirbt, könne in drei bis fünf Jahren mit Kursgewinnen von 30 Prozent und mehr rechnen.
Kritische Analysten sehen das anders. Dmitri Alexandrow spricht von Ablasshandel. Mit Übernahme riskanter oder gar fauler Aktiva erkauften sich Oligarchen Vergebung aller Sünden. Liquide Unternehmen dagegen würden als Gegenleistung für erwiesene Loyalität verkauft. Viele Topmanager von Staatsbetrieben seien jetzt, da die Angebote wohlfeil seien, scharf auf Anteile an Unternehmen, die sie nur leiten, glaubt Wirtschaftsguru Michail Deljagin.
Viele Beobachter ziehen Parallelen zu Boris Jelzins verkorkster Privatisierung in den wilden Neunzigern. Jetzt sei das Schema noch sehr viel krimineller, fürchtet Finanzexperte Slawa Rabinowitsch. Profitieren würden die, die »geopolitische Abenteuer angezettelt« und damit die Krise erst losgetreten hätten. Die Privatisierungen würden die Misere jedoch nicht beenden. Putin werde in spätestens 20 Monaten des Geld ausgehen, der Markt als »kollektiver Verstand der Investoren« auf den drohenden Kollaps schon erheblich früher reagieren. Von sozialen Unruhen, Separatismus, womöglich sogar Bürgerkrieg geschüttelt, werde Russland im Chaos versinken.
Ganz so schwarz sieht Wirtschaftswissenschaftler Dmitri Trawin zwar nicht, kommt aber zu ähnlichen Schlussfolgerungen. Die Krise werde mit Stagnation enden, dadurch würden die Mittel für den Schuldendienst fehlen. In der Tat will das Finanzministerium die Kassen nicht nur mit Veräußerung von Staatseigentum, sondern auch mit Anleihen im Ausland füllen. Allein mit Eurobonds, so Vizefinanzminister Sergei Stortschak Anfang Februar, wolle man drei Milliarden US-Dollar erlösen.
Auslandsschulden, Absturz der Ölpreise und der Afghanistankrieg wurden schon der Sowjetunion zum Verhängnis. Nach drei-vier Jahren, warnt Ökonom Trawin, sei Russland pleite.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.