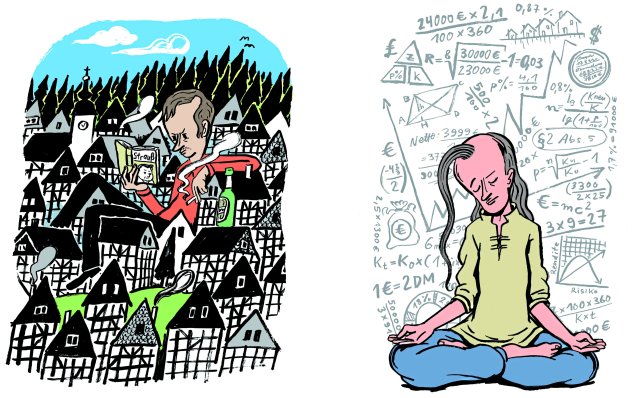Mit vermeintlicher Transparenz gegen Pegida
Die Netzwoche über die Informationspolitik der Polizei und die Nennung der Herkunft von Straftätern
Zeitungen haben es im Mutterland von Pegida schwer. Die »Sächsische Zeitung« (SZ) mit ihrem Hauptbüro in Dresden sitzt aus geografischer Perspektive sogar im Schoß der rassistischen Bewegung, weiß also wahrscheinlich mehr als manch anderes Medienhaus, wie es ist, mit den Fremdenfeinden Tür an Tür arbeiten zu müssen. In der täglichen Praxis hat dies für die SZ Folgen: Die Kollegen bekamen selbst schon Pegida-Besuch. Bei der »SZ« sind sie es gewohnt, als »Lügenpresse« angefeindet zu werden.
Da überrascht es doch, dass die Zeitung nun erklärt, eine Richtlinie des Deutschen Presserates künftig zu ignorieren. Das Medienhaus entschied sich, die Herkunft von Straftätern oder Tatverdächtigen in »jeden Fall« zu nennen. Laut Ziffer 12.1 des Pressekodex ist die Nennung nur erlaubt, wenn »für das Verständnis des Vorgangs begründeter Sachbezug besteht«. Die Zeitung begründete ihre Entscheidung vergangene Woche unter der Überschrift »Fakten statt Gerüchte«. Darin argumentiert »SZ«-Redakteur Oliver Reinhard, es sei »ja kein Geheimnis, dass etliche Deutsche glauben, die Medien würden in ihrer Berichterstattung die Herkunft ausländischer Straftäter aus Rücksicht auf diese verschweigen.«
Nun ist »Rücksicht« in diesem Fall das falsche Wort, der Presserat erklärt in der Richtlinie explizit, warum er die Nennung der Herkunft für problematisch hält: »Besonders ist zu beachten, dass die Erwähnung Vorurteile gegenüber Minderheiten schüren könnte.« Die »SZ« glaubt, dieser Diskriminierung mit scheinbarer Transparenz entgegenzuwirken. Chefredakteur Uwe Vetterick sagte auf tagesspiegel.de, gegenwärtig werde »Raum für Gerüchte geschaffen, die denjenigen schaden, die wir eigentlich schützen wollen«.
»Die Anwendung des Pressekodex kann keine einseitige Rosinenpickerei sein«, warnte der Chef des Deutschen Journalistenverbandes, Frank Überall. Die Richtlinien müsste für alle gelten, wenngleich sich die »SZ« dafür einsetzen könne, den Passus streichen zu lassen. Dass eine klare Mehrheit im Presserat gegen eine Streichung ist, zeigte sich zuletzt im März. Das Gremium wandte sich klar gegen eine entsprechende Initiative der »Nord-West-Zeitung«. Medienjournalist Stefan Niggemeier hatte damals auf Übermedien.de argumentiert, allein die Annahme, die Herkunft eines Täters sei quasi immer relevant, sei bereits ein Problem, da die Nationalität nicht erkläre, warum jemand eine Tat begehe.
Auf ein praktisches Problem weist Karolin Schwarz auf brueckentechnologie.org hin: Bereits die Polizei selektiere die Inhalte ihrer Pressemitteilungen stark vor. Welche Straftaten bekannt würden und ob die Dienststelle überhaupt die Nationalität benenne, hänge in großem Maße vom jeweiligem Diensthabenden ab. Auch SZ-Chef Vetterick räumt ein, man sei von der Informationspolitik der Polizei abhängig. Angesichts dessen darauf zu beharren, künftig die Herkunft von Tatverdächtigen zu benennen, erinnert dann doch eher an gefährliche Willkür.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.