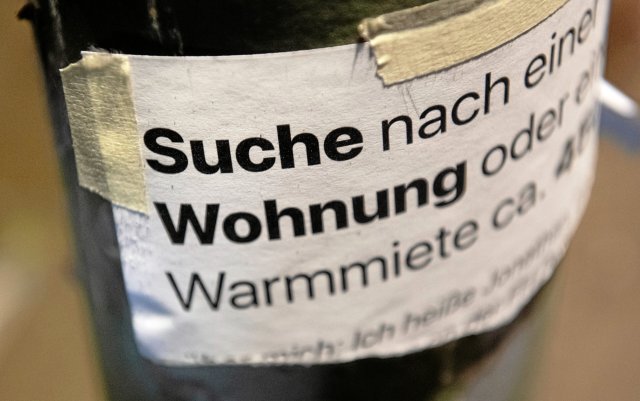Hillary Clinton will Arbeit schaffen
Nominierungsrede der Kandidatin und alles gut nach dem Parteitag der US-Demokraten
Die grell-bunte Show, mit der die USA-Demokraten in den Hauptwahlkampf um das Weiße Haus einsteigen, war Donnerstag zu Ende. Als Höhepunkt des Spektakels hielt Hillary Clinton eine Nominierungsrede, die von großen Versprechungen geprägt war. Als USA-Präsidentin werde sie das größte Arbeitsbeschaffungsprogramm seit Ende des Zweiten Weltkriegs zur Priorität »vom ersten bis zum letzten Tag« ihrer Amtszeit machen. Weitere Reformankündigungen: Gratis-Hochschulausbildung, stärkere Besteuerung von Wall-Street-Firmen, Großkonzernen und Superreichen sowie Widerstand gegen die Waffenlobby.
Direkt wandte sich Clinton an den demokratischen Sozialisten Bernie Sanders und seine 13 Millionen Wähler. Nur mit deren »Ideen, Energie und Leidenschaft« lasse sich das fortschrittliche Parteiprogramm »in einen echten Wandel für Amerika umsetzen«. Gespickt war ihre Rede mit Kritik an Äußerungen, Geschäftsgebaren und Persönlichkeit des Rechtspopulisten Donald Trump.
Erst nach 20 Minuten Redezeit ging Clinton auf den historischen Moment ein, dass die »gläserne Decke«, die den Aufstieg von Frauen behindere, mit ihrer Nominierung durchbrochen sei. Zum ersten Mal in der Geschichte der USA wurde eine Frau zur Präsidentschaftskandidatin einer großen Partei gewählt. Dass das Land weltweit damit zurückliegt, blieb dabei unerwähnt. Die Demokraten erhoffen sich von dem Parteitag, zu dem 20 000 Journalisten angereist waren, in den kommenden Tagen einen Umfragesprung nach vorne.
Die meisten abendlichen Reden waren von den großen Fernsehsendern live ausgestrahlt worden. Fast alle Medien neigen, wie der politische Mainstream, zu Clinton. Dennoch und trotz des finanziell weitaus besser gestellten Wahlkampfapparats von Clinton hatte sich der Immobilienmogul Trump nach dem Parteitag der Republikaner in Cleveland vergangene Woche in Meinungsumfragen knapp vor Clinton gesetzt.
Jetzt dürfte das Pendel wieder zugunsten der Ex-Außenministerin ausschlagen. Ihr Problem bleibt ihre mangelnde Beliebtheit. Selbst innerhalb der Demokratischen Partei ist sie im Vergleich mit anderen Kandidaten der Vergangenheit unpopulär, laut Umfragen bei fast einem Drittel.
Im Gegensatz zum Republikaner-Parteitag, den Mainstream-Rechte und Konservative aus der Kulturszene mieden, zeigten sich die Demokraten in Philadelphia mit ihrem »Dream Team«. Am Montag, als sich der demokratische Sozialist Bernie Sanders hinter Clinton stellte, hielt First Lady Michelle Obama eine hoch gelobte Rede. Am Dienstag zeichnete Ex-Präsident Bill Clinton seine Ehefrau als Geliebte, Mutter und Kämpferin mit einem Gespür für Fürsorge und Fortschritt. Am Mittwoch wandte sich Vizepräsident Joe Biden mit Kraftausdrücken, die gegen Trump gerichtet waren, direkt an die weiße Arbeiterschicht.
Barack Obama folgte ihm - ungewöhnlich für einen amtierenden Präsidenten - mit scharfen Attacken auf den politischen Gegner Trump und einem flammenden Wahlaufruf für Clinton. Sie revanchierte sich mit einem »Überraschungsauftritt« unmittelbar nach seiner Rede und einer langen Umarmung.
Der den Delegierten und den Wählern kaum bekannte Kandidat für das Amt des Vizepräsidenten Tim Kaine stellte sich ebenfalls vor. Dabei bezog sich der Senator aus Virginia ausdrücklich positiv auf seinen Kollegen Bernie Sanders, mit dem er im selben Haushaltsausschuss sitzt. Ein weiterer der wenigen Demokraten, die Sanders lobten, war Präsident Obama. In politischer Hinsicht stimmte er dem Sozialisten zu. Von der kommunalen bis zur präsidialen Ebene müssten »wir Demokraten wählen gehen, denen wir dann so lange auf die Finger schauen, bis sie ihre Arbeit erledigt haben«.
Für eine Minderheit von Delegierten, die für Bernie Sanders zum Parteitag gekommen waren, kam dieses Integrationsangebot jedoch zu spät. Schon zu Beginn hatten die Wikileaks-Enthüllungen, die die Voreingenommenheit der Parteiführung zugunsten von Clinton unter Beweis stellten, für lautstarke Proteste gesorgt. Der auf russische Hacker gelenkte verdacht und ein Rücktritt von Parteichefin Debbie Wasserman Schultz dämpften den Ärger nicht. Selbst Bernie Sanders wurde nach seinem Aufruf für Clinton ausgebuht.
Während des Parteitags hielten Dutzende von Delegierten Schilder gegen das Freihandelsabkommen TPP in die Kameras. Pentagonchef Leon Panetta wurde bei seiner Rede mit den lautstarken Ruf »No more wars« unterbrochen. Im Stadtzentrum von Philadelphia und entlang der Absperrung zur Parteitagsarena kam es vier Tage lang zu Protesten.
Gegenüber »nd« sagte die Präsidentschaftskandidatin der USA-Grünen Jill Stein, das »Problem des Wählens des kleineren Übels« Clinton könne nur durch eine dritte Partei gelöst werden. Die Frage, ob Stimmen für sie statt für Clinton eine Trump-Präsidentschaft nicht wahrscheinlicher machen würden, beantwortete sie mit dem Hinweis, »die neoliberale Politik der Clintons hat ein Phänomen wie Trump erst möglich gemacht«. Eine andere Strategie verfolgen die Democratic Socialists of America, die größte linkssozialdemokratische Gruppierung. Im »nd«-Gespräch sagte ihre Vorsitzende Maria Svart, zusammen mit der Sanders-Bewegung gehe es primär darum, »mit der Wahl von Clinton eine Trump-Präsidentschaft zu verhindern«, und dann die linke Grasswurzelbewegung in den USA auszubauen.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.