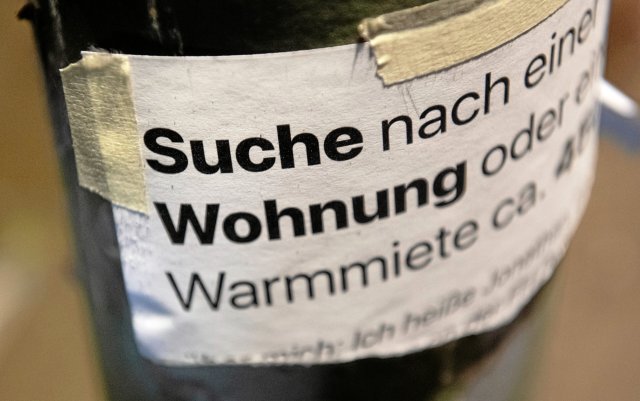Die Schutzhaft im Kaiser- und Nazireich
Freiheitsentzug ohne den Nachweis einer konkreten Straftat - das weckt in Deutschland unter dem Stichwort »Schutzhaft« düstere Assoziationen. Als »Schutzhaft« wurden historisch jedoch recht verschiedene Regelungen bezeichnet.
Im Preußischen Königreich bezeichnete der Ausdruck zunächst eine kurzfristige Polizeiinternierung, die nur einen Tag andauern durfte. 1851 wurde sie für den »Belagerungszustand« entfristet und richterlicher Kontrolle entzogen.
Im Ersten Weltkrieg wurde das Instrument einer solchen »Schutzhaft« gegen Oppositionelle eingesetzt, etwa gegen Rosa Luxemburg. Im Übergang zur Republik existierte die »Schutzhaft« zunächst weiter, der SPD-Minister Gustav Noske setzte 1919 Streikende auf dieser Basis fest.
Nach der Weimarer Verfassung war »Schutzhaft« dagegen eine verschärfte Haft, eine Inhaftierung ohne Richter und Anwaltsbeistand gab es nicht. Beides wurde im Februar 1933 in der »Verordnung zum Schutz von Volk und Staat« eingeführt. Dann konnte die Polizei »Gewohnheitsverbrecher« und konnten SS, SA und Gestapo Oppositionelle ohne Anwalt und Richter wegsperren. nd
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.