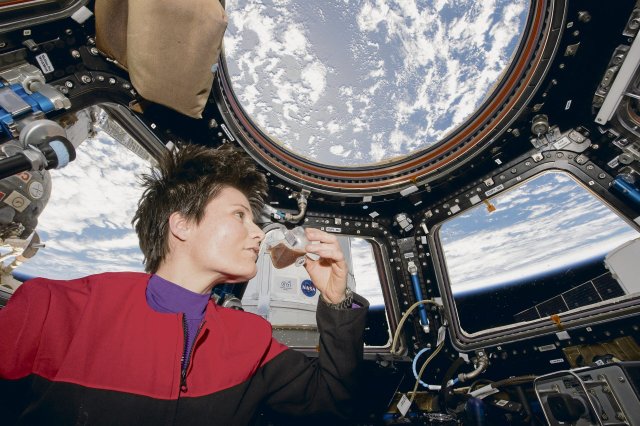Laissez-Faire-Pädagogik
Bildungslexikon
Irrtümlicherweise wird die sogenannte Laissez-Faire-Pädagogik mit der antiautoritären Erziehung gleichgesetzt. Der aus dem Französischen stammende Begriff laissez-faire bedeutet soviel wie »machen lassen«. Erstmals bekam er 1707 durch den Ökonomen Pierre Le Pesant de Boisguilbert Bedeutung. »Man lasse die Natur machen«, heißt es in seiner Schrift. Um 1751 folgte der Aufruf »laissez faire et laissez passer, lassen Sie machen und lassen Sie passieren«. Gemeint war, der Staat möge nicht in die Ökonomie eingreifen. Mit dieser Maxime wurden Gewerbefreiheit und Freihandel gegen den Merkantilismus propagiert.
1890 übertrug Kurt Tsadek Lewin, Pionier der Psychologie und Mitbegründer der Sozialpsychologie und Gestaltpsychologie, diese Maxime in die Pädagogik. Kinder sollten sich selbst und ihrem Entwicklungsprozess überlassen werden.
Während die Laissez-Faire-Pädagogik also im Wesentlichen eine Handlungsmaxime darstellt, ist die antiautoritäre Erziehung, die in Deutschland ab Ende der 1960er Jahre populär wurde, ein Konzept, das sich ausdrücklich gegen einen vernachlässigenden Erziehungsstil wendet, aber eben auch gegen eine von Verboten beherrschte Erziehung. Die Erziehung soll stattdessen von Zwängen und der Übermacht der Pädagogen möglichst befreit werden. tgn
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.