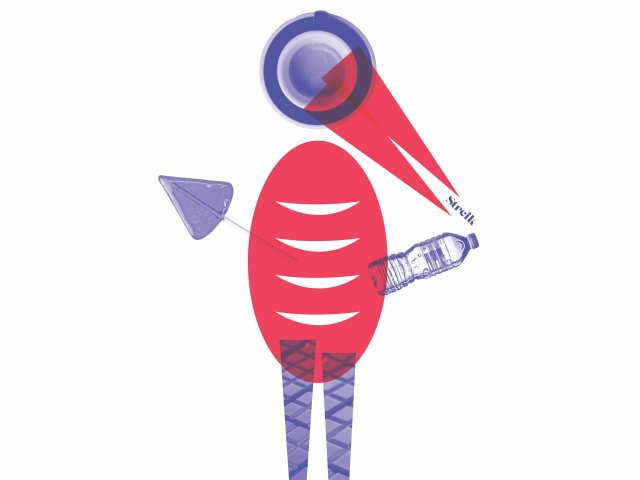Zwei ungleiche Bewerber für das Weiße Haus
Hillary Clinton und Barack Obama wollen Präsidentschaftskandidat der Demokraten werden
Eine Frau, die alle Rekorde bricht
Der zum Popstar avancierte Obama wird allerdings, um Clinton vielleicht überflügeln zu können, noch zahlreiche politische Flugstunden absolvieren müssen. Clinton hat mit ihrer erfolgreichen Karriere als Anwältin, First Lady, Senatorin und ganz vorn liegende Präsidentschaftsanwärterin alle amerikanischen Rekorde gebrochen. In keiner der beiden Parteien hat es eine Frau bisher so weit geschafft. Setzt sie sich im nächsten Jahr durch, wäre sie nicht nur die erste Frau, die von einer großen Partei zur offiziellen Kandidatin nominiert wurde, sondern auch die erste Präsidentin der USA.
Bekannt ist die 59-Jährige den Amerikanern seit 1992, als sie mit ihrem Ehemann und neu gewählten Präsidenten William Clinton ins Weiße Haus einzog. Die Nation wartete gespannt darauf, was der etwas seltsame Spruch bedeuten mochte, den Clinton im Wahlkampf abgab: »Wer mich wählt, bekommt zwei für den Preis von einem«, hatte der mit einem Blick auf Hillary seinen Anhängern versprochen - womit der Begriff »Billard« geboren war.
Tatsächlich ließ sich Hillary Clinton nie auf repräsentative Aufgaben reduzieren, sondern startete eigene Initiativen, etwa den Versuch einer groß angelegten Gesundheitsreform. Schon damals zog sich die brillante Karriereanwältin - sie wurde zwei Mal als eine der einflussreichsten Anwältinnen der USA ausgezeichnet - den Zorn von Antifeministen zu. Sie übe zu viel Einfluss auf den Präsidenten aus, hieß es, sie sei berechnend. Parteiübergreifende Bewunderung erntete Hillary Clinton allerdings, als sie mehrere Affären ihres Mannes verarbeitete, ohne die Ehekrise nach außen dringen zu lassen. Sowohl sein Gezirze mit der Nachtklubsängerin Gennifer Flowers als auch den Sexskandal mit der Praktikantin Monica Lewinsky schien sie ihm zu verzeihen.
In einer Umfrage lauteten denn auch die wichtigsten Eigenschaften, die Hillary Clinton angeblich besitze: stark, klug, mutig, gütig, loyal. Quer durch die konservative Bank wird sie hingegen als »unweiblich«, »roboterhaft«, »Hexe« oder »versteckte Lesbe« attackiert.
Dabei hat sie mit den Auffassungen des konservativen Lagers mehr gemeinsam als mit denen des linksliberalen Flügels der Demokraten. So befürwortet sie die Todesstrafe und hat sich bis heute im Gegensatz zu anderen Demokraten, die den Irak-Krieg anfangs unterstützten, davon nicht eindeutig distanziert. Im Hintergrund steht eine rein auf den Wahlgewinn ausgerichtete opportunistische Strategie, mit der die Clintons 1992 erfolgreich waren: der Drang in die Mitte und nach rechts.
Dass Hillary Clinton auf dem innerparteilichen Thron sitzt, liegt an ihrem Bekanntheitsgrad, aber auch an der Tatsache, dass sie sich auf das Spendernetzwerk ihres Mannes und ihre eigene Macht als New Yorker Senatorin stützen kann. Zweifellos wird sie auch aufgrund ihres Erfahrungsschatzes nur schwer von der Führungsposition zu verdrängen sein.
Der Newcomer Barack Obama machte erstmals 2004 landesweit auf sich aufmerksam, als er beim Parteitag der Demokraten in Boston eine gefeierte Rede hielt. Damals wurde zwar John Kerry als Präsidentschaftskandidat nominiert. Doch die Begeisterung, die Obama auslöste, veranlasste selbst Konservative dazu, den Juristen als »Hoffnungsträger der neuen Generation« und »politisches Naturtalent« zu bezeichnen. In der geschliffenen und mit Ehrlichkeit vorgetragenen Rede geißelte Obama den Zynismus und die Grabenkämpfe des Washingtoner Establishments. In den Vordergrund stellte er das »Wertesystem der Gründerväter« und die Besinnung auf »Amerikas Ideale«, denen statt bloßer militärischer Drohgesten weltweit wieder Geltung verschafft werden müsse.
Ein Schwarzer, den Weiße nicht fürchten
Kurz darauf wurde Obama in Illinois mit großer Mehrheit zum Senator gewählt, womit er der einzige Afroamerikaner im USA-Oberhaus wurde, der fünfte in der amerikanischen Geschichte. In seinem Buch »The Audacity of Hope« breitet der heute 45-Jährige in einem Schlüsselkapitel seine Philosophie aus, die er als Herausgeber der juristischen Fachzeitschrift »Harvard Law Review« und später als Lehrer für Verfassungsrecht in Chicago entwickelte. Die Amerikaner könnten ein Maximum an Selbstbestimmung nicht in politischen Gefechten zwischen Liberalen und Konservativen erreichen, sondern in einem an der Verfassung ausgerichteten Wertekanon, und der glänze durch seinen Bezug auf die Vielfältigkeit der Gesellschaft. Die Demokratie lebe zwar von politischer Konkurrenz, doch das Abgehen vom gemeinsamen Nenner »Our Constitution« zerstöre ihre Lebendigkeit.
Obamas Familiengeschichte ist die Verkörperung der amerikanischen Multikulturalität. Er wurde in Hawaii geboren. Sein Vater ist ein schwarzer Kenianer, seine Mutter eine Weiße aus Kansas. Barack wuchs mit seiner Mutter und deren zweitem Ehemann, einem Indonesier, in Jakarta auf, wo er eine muslimische und darauf eine katholische Schule besuchte. Er gehört heute einer protestantischen Gemeinschaft an und lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in einem Vorort von Chicago.
Die partei- und klassenübergreifende Konsensrhetorik von der »Hoffnung« und eine kosmopolitische Lebensgeschichte sind allerdings kein Parteiprogramm und auch nicht ausreichend für einen Präsidentschaftskandidaten. Dass Obama dennoch in Massenmedien einem Popstar gleich die Titelseiten schmückt und bei öffentlichen Auftritten von Tausenden bejubelt wird, spricht für das Bedürfnis nach neuen Gesichtern in der Unterhaltungsindustrie, aber auch in der Öffentlichkeit. »Ein Stück von allem« sei in seiner charismatischen Person zu finden, lobte die »New York Times«.
Der linken »Nation« sind dagegen die Abwesenheit konkreter politischer Aussagen und der Personenkult um den Senator suspekt. In einem Kommentar vermutete die Zeitschrift hinter der Begeisterung, die ihm viele weiße Amerikaner entgegenbringen, einen unterschwelligen Rassismus. Obama sei »ein schwarzer Mann, den Weiße nicht fürchten«. Dafür schlägt Obamas Ablehnung des Irak-Kriegs, die er schon 2002 deutlich zum Ausdruck brachte, sehr positiv zu Buche.
Obamas PR-Strategie wird von seinem Freund David Axelrod koordiniert, dessen Firma AKP Media schon zahlreichen Politikern, vor allem Afroamerikanern, auf einzelstaatlicher Ebene zu Erfolgen verhalf. Auf Axelrod geht denn auch die häufige Verwendung des Begriffs »Hoffnung« zurück. Dieser sei von Politikern vielfach zum Klischee verbraten worden, heißt es in einer Analyse der »Nation«. Doch in der derzeitigen Wahlkampfsaison gebe es auf diesen Markennamen eine besondere Resonanz im Amerika nach dem 11. September und mitten im Irak-Krieg.
Die Erfahrung von »9/11« gab den Amerikanern ein Gefühl nationaler Solidarität. Jene Tage eröffneten einen flüchtigen Blick auf eine Zukunft ohne Kultur-Krieg, ohne Reizthemen und tribalistische Rechts-Links-Schemata. Jetzt, da ein grauer, militaristischer Alltag eingekehrt sei, würden die Amerikaner mehr erwarten. Mit Obama sei da ein Hoffnungsschimmer aufgetaucht.

Zum Aktionspaket
Linken, unabhängigen Journalismus stärken!
Mehr und mehr Menschen lesen digital und sehr gern kostenfrei. Wir stehen mit unserem freiwilligen Bezahlmodell dafür ein, dass uns auch diejenigen lesen können, deren Einkommen für ein Abonnement nicht ausreicht. Damit wir weiterhin Journalismus mit dem Anspruch machen können, marginalisierte Stimmen zu Wort kommen zu lassen, Themen zu recherchieren, die in den großen bürgerlichen Medien nicht vor- oder zu kurz kommen, und aktuelle Themen aus linker Perspektive zu beleuchten, brauchen wir eure Unterstützung.
Hilf mit bei einer solidarischen Finanzierung und unterstütze das »nd« mit einem Beitrag deiner Wahl.