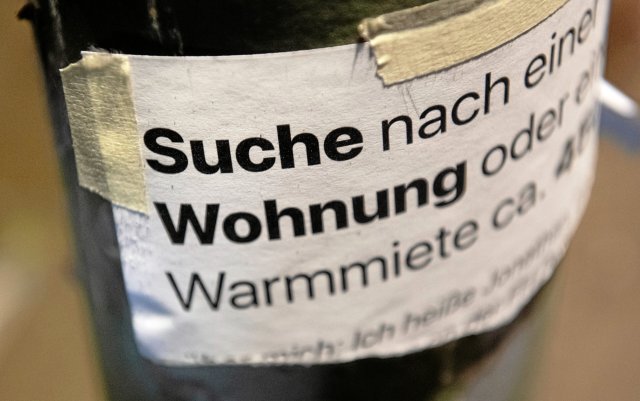Streit ums Geld ist programmiert
Der Sondergipfel beschäftigt sich erstmals mit dem neuen mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union ab 2021
Er ist so etwas wie ein Fünfjahresplan der EU, der sogenannte mehrjährige Finanzrahmen (MF). Für den Zeitraum von zwischen fünf und sieben Jahren kalkuliert die EU regelmäßig bereits im Voraus, wie viel Geld sie in diesem Zeitraum ausgeben will. Wie genau die Mittel dann jedes Jahr verteilt werden, wird später in den jährlichen Haushaltsplänen festgelegt. Es geht also um wichtige Weichen, die mit dem Finanzrahmen gestellt werden - und mit dem Weichenstellen für die Zeit zwischen 2021 und 2027 hat die EU jetzt begonnen. Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) arbeitet schon lange daran, denn er soll, in Abstimmung mit seinen Kommissarskollegen, im Mai erste Pläne vorlegen. Dafür hat er in den vergangenen Monaten die EU-Hauptstädte besucht und schon einmal vorgefühlt, wie die Stimmung in den einzelnen Ländern ist. Gleichzeitig warb er dort ein erstes Mal für seine eigenen Ideen.
Die gehen von zwei Überlegungen aus: Erstens werden die Briten den MF nicht mehr mitfinanzieren, weil sie die Union ja verlassen wollen. Zweitens soll der Rahmen den ambitionierten Zukunftsplänen Rechnung tragen, die die 27 verbleibenden EU-Staaten in Folge des Brexit-Votums auf dem Gipfel in Bratislava 2016 und mit der Erklärung von Rom 2017 für die Europäische Union formuliert haben. Konkret heißt das: Ohne die Briten steht weniger Geld zur Verfügung, aber die Ziele, die sich die EU stellt, kosten nun mal viel Geld. Wie kommt das zusammen?
Vergangene Woche hat Oettinger ein Papier veröffentlicht, das als Diskussionsgrundlage für die EU-Staats- und Regierungschefs am Freitag dienen soll. Sie werden sich dann erstmals mit dem neuen MF beschäftigen. Letztlich müssen sie ihn im Einklang mit dem Europaparlament absegnen. Ziel von Oettinger ist es, dass dieses Papier am 9. Mai 2019 angenommen wird. Danach nämlich finden Europawahlen statt, wodurch die EU monatelang in ihren Entscheidungsprozessen blockiert sein wird.
Der lange Vorlauf für die Diskussionen ist deshalb nötig, weil es um erhebliche Finanzmittel geht. Bezahlen will keiner gern. Deshalb ist schon eingeplant, dass zunächst gestritten wird, um über Kompromissphasen letztlich doch zu einer Einigung zu kommen. Das braucht Zeit. Deshalb sollen sich nach dem Wunsch der Kommission die EU-Staats- und Regierungschefs am Freitag zunächst Fragen stellen. Fragen wie: Sind wir dazu bereit, mehr Geld für die EU auszugeben. Wenn ja oder nein: Welche Konsequenzen wird das haben?
Das Oettinger-Papier verdeutlicht solche Überlegungen mit Zahlen. Die EU möchte ihre Außengrenzen besser schützen? Wenn man das ambitioniert angeht, dann kostet es rund 150 Milliarden Euro im Finanzrahmen, wie Oettinger vorrechnet. Das EU-Grenzschutzsystem hätte für dieses Geld dann das Niveau der USA oder Kanadas. Weniger ambitionierte Pläne würden nur 20 bis 25 oder gar nur acht Milliarden Euro kosten.
Auch eine Reform des EU-Haushalts sei möglich. Man könne die Ausschüttung von Geldern an einzelne Staaten an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit knüpfen, so Oettingers Vorschlag. Brüssel könnte auch eigene Finanzquellen bekommen, um nicht mehr komplett von den Zahlungen der Mitgliedstaaten abhängig zu sein. Die riesigen Töpfe für Agrarsubventionen und die Entwicklung ärmerer Regionen könnten neu gestaltet werden, um mehr Geld für andere Projekte zu haben, zum Beispiel für die Mobilität junger Menschen.
Dass es zu all dem unterschiedliche Meinungen geben wird, wurde schon vor dem Gipfel klar. So ist etwa im aktuellen Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD die Bereitschaft zu mehr Ausgaben für EU-Belange formuliert, eine Position, die auch Frankreich und Finnland offiziell einnehmen. Die Regierungen der Niederlande, Österreichs, Schwedens und Dänemarks dagegen haben schon klar gemacht, dass sie ihre Beiträge zum EU-Haushalt nicht erhöhen wollen. Ganz zu schweigen von den eher EU-skeptischen Ländern wie Ungarn, Polen oder Tschechien.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.