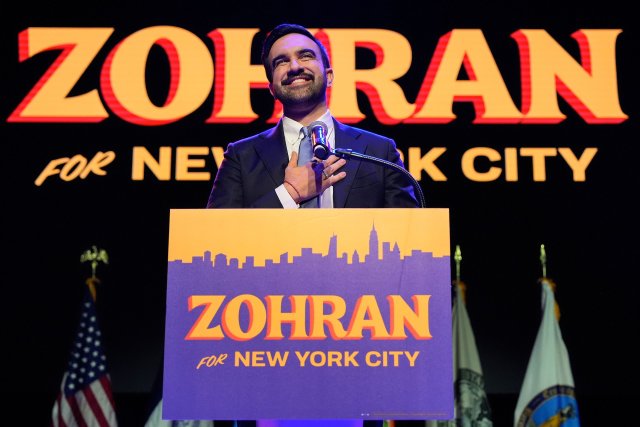Lebensabschnitt DDR
Nach dem Putsch in Chile 1973 kamen etwa 2000 Flüchtlinge in den sozialistischen Teil Deutschlands
Chile und die DDR - gerade jüngeren Menschen fällt zu diesem Länderpaar zunächst die Episode ein, dass Erich Honecker, seines Zeichens letzter Generalsekretär des Arbeiter- und Bauernstaats, sich Anfang der 1990er Jahre nach Santiago de Chile zurückzog. Dabei ist das Verhältnis beider Länder vor dem Mauerfall eigentlich viel spannender ...
Ja, und die Beziehung der beiden Länder vor 1989 ist auch der Grund dafür, warum die Chilenen Honecker überhaupt aufnahmen. Die Solidarität, die viele Chilenen und Chileninnen nach dem Putsch in Chile 1973 von der DDR erfuhren, war schon besonders.
Chile hatte die DDR 1971 diplomatisch anerkannt und verlor mit dem militärischen Sturz Allendes dann einen wichtigen Verbündeten.
Die ganze Welt hat sich das Experiment Allende angeschaut und gehofft, dass es Veränderungen bringen würde. Das war kein DDR-spezifischer Verdruss.
Anders als andere Staaten schloss die DDR nach dem Putsch am 11. September 1973 ziemlich schnell ihre Botschaft in Santiago.
Ja, es musste schnell gehen, der Botschafter verbrannte nach dem Putsch im Hof die Akten. Vor der Schließung wurden noch die Chilenen ausgeflogen, die sich dorthin geflüchtet hatten. Später übernahm dann die Schweiz die konsularischen Rechte der DDR und managte das weiter.
Für die Menschen aus Chile, die sich in die DDR flüchteten, war es zunächst ein fremdes Land. Wie fanden sie sich in diesem anderen real existierenden Sozialismus zurecht?
Nach allem was ich gehört und in den Archivakten gelesen habe, bin ich erstaunt, wie gut sich die Chilenen im Osten einlebten. Schriftsteller wie Carlos Ceda und Roberto Ampuero (heute chilenischer Außenminister, N.B.) berichten in ihren Romanen zwar nicht viel Positives über die DDR. In den Interviews, die ich mit Exilanten geführt habe, klang das anders. Vor allem die, die nach Chile zurückgekehrt sind, sehen die DDR als wichtige Episode ihres Lebens, als einen lehrreichen Auslandsaufenthalt. Ich glaube, während des Exils haben sie das sicher noch nicht so bewertet, denn es war ja nicht klar, ob es ein Zurück geben würde.
Es heißt immer, die Chilenen führten im Vergleich zu Menschen aus Mosambik oder Vietnam in der DDR ein recht privilegiertes Leben.
Ja, so konnten sie zum Beispiel einfach in den Westen fahren. Und sie erhielten viel staatliche Unterstützung, angefangen bei der Wohnungsbeschaffung. Chilenen konnten sich auch dreimal beschweren, wenn ihnen ihr Job oder Studienplatz nicht gefiel. Und dann haben sie auch jedes Mal einen anderen bekommen. Das fand ich schon erstaunlich.
Warum fallen dann gerade die Erinnerungen prominenter Politexilanten teils so bitter aus?
Ehrlich gesagt glaube ich, dass das an den Möglichkeiten jedes Einzelnen lag, sich zu verwirklichen. Carlos Altamirano zum Beispiel war ein Politiker, der sich in der Welt auskannte. Und der hockte nun in dieser kleinen DDR, wo er nicht so agieren konnte, wie er wollte. Das war für die DDR auch problematisch, weshalb sie seine Ausreise 1979 nach Frankreich nicht nur erlaubte, sondern unterstützte.
Omar Saavedra Santis blieb länger und nahm sich die Freiheit heraus, in seinem 1983 in der DDR veröffentlichten Buch »Blonder Tango« zu fragen, »ob man bei so viel Sicherheit wirklich glücklich sein kann«. Die DDR rechtfertigte die Überwachung prominenter Exilanten auch damit, sie vor Anschlägen des chilenischen Geheimdienstes schützen zu müssen.
Das halte ich für kommunistische Paranoia. Ich habe weder in chilenischen noch in den DDR-Archiven Hinweise darauf gefunden. Dennoch wurde beispielsweise Altamirano immer von Fahrern des Ministeriums für Staatssicherheit begleitet, damit ihm ja nichts passiert.
Welches Ziel wurde mit der Verteilung von geschätzten 2000 Chilenen auf Städte wie Halle, Rostock, Dresden oder das damalige Karl-Marx-Stadt verfolgt? Eine bessere Integration oder war es auch der Versuch, eine zu starke eigenständige politische Arbeit zu verhindern?
Schwer zu sagen, ob das Planung war oder eher dem Zufall geschuldet. Vielleicht war auch gerade ein neuer WBS-70-Wohnblock fertig geworden. Wohnraum zu finden, war tatsächlich das größte Problem. Insgesamt ist schon ziemlich viel ad hoc entschieden worden, abgesehen vielleicht von den chilenischen Künstlern, die alle in Rostock angesiedelt wurden. Da gab es schon einen Plan, deren kreative Arbeit dort zu bündeln.
Chilenen in Ost- und Westdeutschland waren anfangs über die Grenze hinweg in der Initiative Chile Antifascista organisiert, um politisch gegen das Pinochet-Regime zu arbeiten. Die DDR-Führung soll dieses Engagement nicht sonderlich goutiert haben.
Ich weiß nur, dass die DDR nicht begeistert war, dass die Chilenen viel reisten, schon gar nicht in den Westen. Man hatte Sorge, dass sie da mit anderen Chilenen in Kontakt kommen und die ihnen ideologische Flausen in den Kopf setzen könnten.
Nach dem Amnestiegesetz 1978 konnten viele Exilanten zurück nach Chile. Doch einige blieben auch für immer in Deutschland.
Das mit der Rückkehr ist schwierig zu fassen. Es gab Exilanten, die wollten sofort zurück, um sich politisch zu engagieren. Andere hatten in der DDR geheiratet, die wollten dann nicht unbedingt wieder gehen. Die Rückkehrer hatten es schwer, denn die Zeit war während der Diktatur nicht stehen geblieben. Sie kannten das Chile der Regierung Allendes, hatten aus der Ferne gegen die Diktatur gekämpft und kamen nun in einem ganz anderen Land an.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.