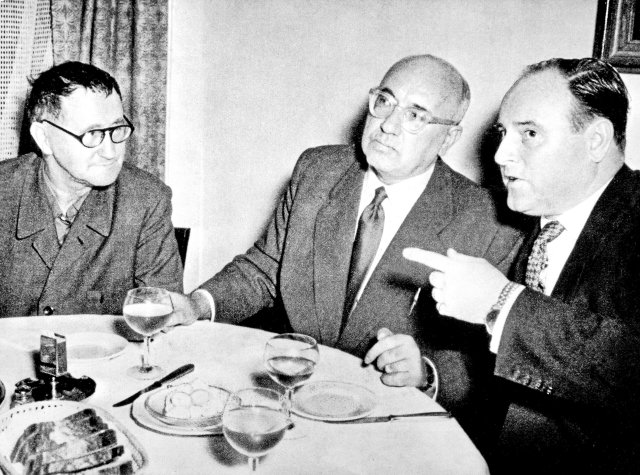Was mich interessiert, ist nicht immer das, was mich angeht.
Paul Valery
Ein halbes Jahrhundert später rümpft mancher Kritiker die Nase, wenn er Curzio Malapartes 1944 und 1949 geschriebene Romanreportagen »Kaputt« und »Die Haut« noch einmal zur Hand nimmt. Bücher haben ihre Schicksale, zumal wenn sie uns ein Leben lang begleiten - und herausfordern. »Die Haut« beschreibt die Befreiung Neapels durch die amerikanische Armee, mehr noch: Malaparte gibt Zeugnis über die erfindungsreiche Zähigkeit der Neapolitaner, mit jeder Besatzung fertig zu werden. »Kaputt« ist der Roman des Kriegsberichterstatters Malaparte an den Fronten des Zweiten Weltkriegs. ....................................................................
Es kann mich nur derjenige verstehen und akzeptieren, der nicht vergisst, dass in mir all die Romantik und der Wahnsinn der Deutschen ist; dass ich nicht ein Italiener wie alle anderen bin, sondern was man gemeinhin einen Barbaren nennt. (Und dies haben, natürlich, zuerst meine deutschen Kritiker erkannt und dann die Amerikaner). .................................................................... Beide Bücher erschienen in der deutschen Übersetzung von Hellmut Ludwig 1950 und 1958, broschierte Ausgaben, unsauberer Zeitungsdruck, und für wenig Westgeld am Zeitungskiosk am Bahnhof Zoo zu erwerben. Ich kaufte und las und las, und habe bis heute nicht aufgehört, mich in Malapartes Welt umzusehen. Es ist eine Welt der Niederlagen, in der, wie der Kritiker Klaus Harpprecht unlängst schrieb, Lügen wahr sein können und der Autor uns blendet mit seiner »moralistisch aufgeputzten Schamlosigkeit«. Malaparte, der in den Ersten Weltkrieg zog, und nach einer Gasvergiftung ein Leben lang kränkelte; der die roaring twenties in Berlin und in Paris erlebte, für englische Mode und Aristokratie schwärmte, in anachronistische Duelle verwickelt war und gern einen Snobismus à la Oscar Wilde pflegte -, und hier müsste ich unterm Strich die Widersprüche auflösen und das Charakterbild seiner Persönlichkeit geben können. Es wäre eine Gleichung mit lauter Unbekannten. Anders als Eulenspiegel versteht es Malaparte, den Hals aus der Schlinge zu ziehen, im letzten Augenblick. Wie Eulenspiegel spielt er die Mächtigen gegeneinander aus und hilft den Erniedrigten und Beleidigten. Unter den Augen des »Generalgouverneurs« Frank, dessen Gast er in Warschau ist, verteilt er Lebensmittel und Zuspruch unter den Todgeweihten des Ghettos. Die Gräuel des Krieges gehen verloren in den üblichen Frontmeldungen von Sieg und Verlust. Malaparte aber will uns den Wahnsinn des Krieges zeigen. Er hebt den Gegensatz von gut und böse auf. Wie Picassos Wandbild »Guernica« haben Malapartes al fresco entworfene Szenen eine surreale Überhöhung, eine Schönheit im Augenblick des Verfalls. Dekadenz? Was aber heißt Dekadenz anderes als Verfall, letzte Szene vor Anbruch des neuen Tages. Zuweilen begleitet von etwas viel Wagnermusik. Ihre andere Seite ist die Absurdität. Der Mann, der in Rom den Einmarsch der Amerikaner begrüßt mit dem Ruf Es lebe die Freiheit! wird von einem Panzer überfahren. Seine Haut löst sich vom Pflaster wie ein ausgedientes Fahnentuch. Malaparte ist nicht wie der von ihm verehrte Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit, festhalten will er die entgleitende Gegenwart. Eine Gegenwart, in der die Überlebenden ihre Einsamkeit ertragen müssen. Wer war Curzio Malaparte, am 9. Juni 1898 in Prato in der Toskana geboren, vor 50 Jahren am 19. Juli 1957 in Rom gestorben? Sohn eines nach Italien ausgewanderten Textilingenieurs aus Sachsen, lautete sein bürgerlicher Name Kurt Erich Suckert. Seine italienische Mutter stammte aus Mailand. Aufgewachsen ist er in einer Arbeiterfamilie; seinem Pflegevater Baldi fühlte er sich ein Leben lang verpflichtet, in politischen Bekenntnissen, im Engagement für die Unterprivilegierten. Das Pseudonym Malaparte, Verneinung des siegreichen Napoleon Bonaparte, kokettiert mit dem »schlechten Teil«, so als fühle er sich abgeschoben in die Unterwelt der Rechtlosen. Oder klingt da ein Wort wie Malepartus mit, in der Tierfabel die klug angelegte Behausung des Fuchses? Eine Eulenspiegelei mehr, »in meiner unkorrigierbaren Angewohnheit, schlauer sein zu wollen, als ich in Wirklichkeit bin«. Wichtiger für das eigene Verständnis und für das Verständnis seiner Leser ist ihm der Dualismus Deutschland - Italien. »In mir (ist) all die Romantik und der Wahnsinn der Deutschen«, aufgefangen vom italienischen Sinn für Form und künstlerische Schönheit - und für politische Spekulation. Nach dem Krieg wird er sich zum »Erz-italiener« stilisieren und erklären, er sei das Produkt eines Seitensprungs seiner italienischen Mama. 1921, nach einer Tätigkeit als Attaché des italienischen Botschafters in Belgien und in Warschau, wird er Mitglied der faschistischen Partei. Mussolinis »Marsch auf Rom« will er nicht mitgemacht haben. Wie die faschistische Machtergreifung in Deutschland und in Italien zustande kam, hat er genau studiert. Seine 1932 in Paris erschienene »Technik des Staats-streichs« verallgemeinert die Durchführung unter den Bedingungen der modernen Industriegesellschaft. Entstanden ist ein Handbuch, das eine Stadtguerilla noch heute mit Gewinn studieren kann. Den Journalisten von einst und regierenden Diktator Mussolini karikiert Malaparte in einem satirischen Roman mit dem Titel »Das Chamäleon«. Der Duce schlägt zurück und verbannt ihn, allerdings unter komfortablen Haftbedingungen, auf die Insel Lipari. Nach einem Jahr gelingt es seinen Freunden, unter ihnen Mussolinis Schwiegersohn Graf Ciano, Malaparte in der Toskana und in Ischia unter Hausarrest zu stellen. Mussolini schließt ihn aus der faschistischen Partei aus. Malaparte profitiert von der neu gewonnenen Unabhängigkeit. Seine Frontberichte, die Hitler verärgern, sind frei von jeglicher Propaganda. Malapartes Romane »Kaputt« und »Die Haut« gehören wie Hemingways Romane, wie Pliviers und Ludwig Renns Kriegsbücher, Stefan Heyms »Kreuzfahrer von heute« oder Ehrenburgs Autobiografie zu den unentbehrlichen Zeugnissen des sich in Ideologien und Rechtfertigungen auflösenden zwanzigsten Jahrhunderts. Von 1940 bis 1943 ist Malaparte Kriegsberichterstatter in Frankreich, Griechenland, Jugoslawien, Rumänien und an der russischen und finnischen Front. Es erscheint sein erstes Kriegsbuch »Die Wolga entspringt in Europa«. Nach dem Ende der Ära Mussolini im Juli 1943 kehrt Malaparte nach Italien zurück. Badoglio, der neue Staatschef, lässt ihn verhaften. Die einrückende amerikanische Armee macht ihn in Neapel zu ihrem Verbindungsoffizier, und so entstehen 1944 die ersten Kapitel des Romans »Die Haut«. Vorangestellt werden dem Roman zwei Zitate, die als Malapartes ästhetisches Programm gewertet werden können. Einmal das oben zitierte Wort von Paul Valery, im französischen Original: »Ce qui m'intéresse n'est pas toujours ce qui m'importe«. Und ein Wort von Aischylos, gültig seit der römisch/griechischen Antike: »Wenn die Sieger die Tempel und Götter der Besiegten achten, dann vielleicht erliegen sie nicht dem eigenen Sieg«. Doch galt das auch für die Götter und Tempel des besiegten Faschismus? Gewidmet ist das Buch den »tapferen, guten, anständigen Soldaten Amerikas, meine Waffengefährten von 1943-45, die vergebens für die Freiheit Europas gefallen sind«. Auf der Suche nach der Gegenwart versucht Malaparte eine Neuorientierung. Er nähert sich der italienischen Kommunistischen Partei, doch wird sein Aufnahmeantrag abgelehnt. Das post-faschistische Europa, wohin geht es? Im Roman »Die Haut« beschreibt Malaparte den Aufstand der Jugend gegen das morsche Estab-lishment: Es ist der Aufstand einer homosexuellen Jugend, die auf radikalste Weise die Tabus der Zeit bricht. Ihr bleibt, und damit ist der Autor einverstanden, die Freiheit der Kunst, sobald sie an die Schranken proletarischer Disziplin gerät. Denn die Freiheit der Kunst erfüllt sich nicht in der Freiheit des Proletariats. ....................................................................
Die Chinesen mag ich gern ... Auch ich habe gelitten, als ich die Nachrichten über Budapest in den Zeitungen gelesen habe, aber dieses Leiden ist niemals vom Zweifel begleitet worden. Die große und positive chinesische Erfahrung lässt jeden Fehler vergessen, denn es ist ein offensichtlicher und unbezweifelbarer Beweis, dass innerhalb der Bewegung des Fortschritts die Summe der positiven Fakten immer größer ist als die Summe der Fehler. .................................................................... Dennoch, eine Welt ist im Aufbruch. Malapartes Unruhe ist ungebrochen, er reist nach Frankreich, Lateinamerika und Deutschland. 1956 besucht er die Sowjet-union und die Volksrepublik China. Doch kennt sein Leben eine Mitte, ein Haus, aus dem er Kraft schöpft, und wo er der jeweils Liebsten in seinem Leben ein Zimmer reserviert. 1936 beginnt er auf Capri mit dem Bau eines »futuristischen« Hauses, das einem auf einem Felsvorsprung gestrandeten Schiff gleicht. Die gläserne Kaminwand erlaubt den Blick aufs Meer, so dass sich Feuer und Wasser mischen, ohne sich zu berühren. »Ein Haus wie ich«, nannte Malaparte seinen Fuchsbau. 1963 hat Jean-Luc Godard »La Casa Malaparte« als Kulisse für seinen Film »Die Verachtung« benutzt. Malaparte hatte es in seiner Begeisterung für Mao und das chinesische Experiment in seinem Testament 1957 der chinesischen Regierung vermacht. Die Erben bzw. der italienische Staat fochten das Testament an, so dass das Haus heute eine spärlich eingerichtete »Forschungsstätte« zur Erinnerung an Curzio Malaparte ist. ....................................................................
An dem Tag, da ich begann ein Haus zu bauen, hätte ich nicht gedacht, dass ich ein Porträt von mir selbst entwerfen würde. Ein besseres Porträt, als ich es bisher in der Literatur entworfen hatte. An allem, was autobiographisch in den Werken eines Schriftstellers ist, kann man leicht die Elemente, die Züge seines moralischen Porträts erkennen. .................................................................... Für Malaparte aber sprechen seine Arbeiten. So ist im Eichborn Verlag in diesem Frühjahr, in der Reihe »Die andere Bibliothek«, ein vorzüglich edierter Band mit unterschiedlichen Texten des Kriegsberichterstatters und Weltreisenden erschienen. Unter dem Titel »Zwischen den Erdbeben - Streifzüge eines europäischen Exzentrikers« hat der Herausgeber Jobst Welge einen mit Fotos reich illustrierten Band zusammengestellt. Zum ausführlichen, Malapartes Widersprüche engagiert erklärendem Vorwort kommen zu jeder Abteilung der Texte Welges Kommentare, die Malapartes politische und ästhetische Entwicklung sowie seine Einbindung in die Zeitgeschichte verständlich machen. Die einem deutschen Leser bislang weitgehend unbekannten Arbeiten fügen sich zum Bild eines europäischen Mosaiks der Kriegs- und Nachkriegszeit. Hinzu kommen Reisen nach Lateinamerika und China. »Ein Blick auf das Deutschland von heute« vergibt freundliche Zensuren, weil: »Die Deutschen sind anders geworden.« China aber bleibt für Malaparte das Land der Zukunft, Maos Sozialismus wird auch nicht in Frage gestellt durch den Aufstand in Budapest 1956 und die gewaltsame Niederschlagung durch die Rote Armee. Abgerundet wird der Band durch einen Essay »Die Casa Malaparte« von Bruce Chatwin, jenem inzwischen legendären Weltreisenden und Entdeckers verborgener Schönheit im Alltäglichen. 1956 bricht während einer Chinareise die heimtückische Krankheit aus, die Malaparte seit einer Gasvergiftung im Ersten Weltkrieg bekämpft. Er wird nach Rom geflogen und stirbt am 19. Juli 1957 an Lungenkrebs. Einmal mehr überrascht er seine Umgebung: Er verlangt nach den Sterbesakramenten der Katholischen Kirche. Vergeben sind alle Sünden. Fügen sich am Ende eines Lebens die Widersprüche zur neuen Einheit? Malapartes Widersprüche sind noch immer unsere eigenen Widersprüche. In seinen Büchern sind sie aufgehoben; es liegt an uns, wie wir damit umgehen. Curzio Malaparte: Zwischen Erdbeben. Streifzüge eines europäischen Exzentrikers. Ausgewählt und mit einer Einleitung von Jobst Welge, mit einer Zeittafel und Bruce Chatwins Text »Die Casa Malaparte«. Übersetzt von Michael von Killisch-Horn. Die andere Bibliothek Band 267. Eichborn Verlag. 364 S., geb., 30 ¤. Ausstellung zu Werk und Autor: München, Pasinger Fabrik, vom 13. September bis 18. Oktober.