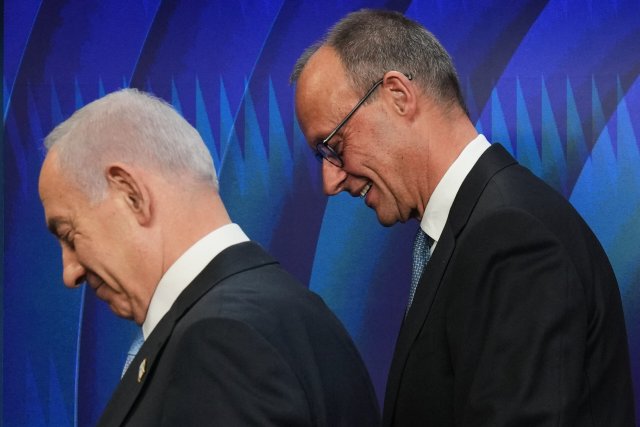- Kommentare
- Kurzarbeitergeld
Rendite durch öffentliche Gelder
Robin Jaspert über den Missbrauch des Kurzarbeitergeldes
Der Kerngedanke von Kurzarbeitergeld ist simpel: Unternehmen sollen in Krisenzeiten darauf verzichten, ihre Angestellten zu entlassen. Um das zu ermöglichen, zahlen Arbeitgeber*innen und Arbeitnehmer*innen zu gleichen Teilen in einen Topf ein, aus welchem in Krisenzeiten die Fortzahlung der Löhne bei reduzierter Arbeitszeit finanziert wird. Dieses Konzept steht hier nicht zur Kritik. Es verpflichtet die Arbeitgeberseite zur finanziellen Beteiligung an der Absicherung der Arbeitnehmer*innen, was aus Arbeiter*innenperspektive absolut erstrebenswert ist. Der Einsatz des Kurzarbeitergeldes hat sich mit Beginn der durch Covid-19 ausgelösten und durch den russischen Angriffskrieg verschärften Wirtschafts-, Inflations- und Energiekrise allerdings grundlegend verändert.
Im April 2020 bezogen insgesamt sechs Millionen Menschen in Deutschland Kurzarbeitergeld – was vor allem durch die kurzfristig erleichterten Zugangsbedingungen ermöglicht wurde. Ein Rekordwert und eine Steigerung von über 10 000 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dieser extrem umfangreiche Einsatz des Instruments mäßigte sich zwar, doch der Ukraine-Krieg und auch die Energie- und Inflationskrise führten erneut zum vermehrten Einsatz der Kurzarbeit. Ein Großteil der für das Kurzarbeitergeld verfügbaren Rücklagen wurde jedoch bereits verbraucht. Die Bundesagentur für Arbeit gab in den Jahren 2020 und 2021 insgesamt 24 Milliarden Euro für Kurzarbeitergeld sowie 18 Milliarden Euro für Sozialleistungen aus der Kurzarbeit aus, was durch Zuschüsse aus Bundesmitteln aufgefangen wurde.
In den aktuellen Regelungen zum Kurzarbeitergeld gibt es nach wie vor keine Bedarfsprüfung der Unternehmen – entscheidend ist ausschließlich die Zahl der Beschäftigten in Kurzarbeit sowie sehr offen gehaltene Gründe für die Reduzierung der Arbeitszeit. Das führte im Jahr 2020 dazu, dass allein die im Börsenindex DAX notierten Unternehmen, die auf das Instrument zugriffen, Dividenden in Höhe von mindestens 13,4 Milliarden Euro zahlten. Die horrenden Kosten für Millionenboni der Manager sowie Aktienrückkaufprogramme zur Bereicherung der Anteilseigner*innen kommen noch dazu. Denn an Konzerne, die die Lohnfortzahlungen der Beschäftigten durch die gemeinsam aufgebauten Rücklagen des Kurzarbeitergeldes finanzieren, werden nach wie vor keine Bedingungen gestellt. Ein Vorstoß der Linkspartei im März 2021 wurde durch die rot-grün-gelbe Regierungskoalition unter Rückgriff auf fadenscheinige Begründungen abgeschmettert.
Durch die Verlängerung des vereinfachten Zugriffs auf das Kurzarbeitergeld ohne eine Reform des Systems ist es auch heute noch Konzernen möglich, Rendite durch den Zugriff auf öffentliche Mittel zu finanzieren. Der Autobauer Mercedes gab in der vergangenen Woche beinahe zeitgleich einen Gewinn von 20,5 Milliarden Euro für das Jahr 2022 und die Anmeldung von Kurzarbeit bekannt. Die Widersprüche sind dermaßen eklatant, dass inzwischen sogar aus dem Lager der Arbeitgeber- und kapitalnahen CDU- und FDP-Fraktionen Kritik ertönt. Verteidigt wird die aktuelle Ausgestaltung des Kurzarbeitergeldes von dem SPD-geführten Bundesarbeitsministerium damit, dass eine Bedarfsprüfung der Unternehmen einen nicht zu stemmenden administrativen Aufwand bedeuten würde.
Administrativ einfach umzusetzen wäre hingegen das Verbot der Zahlung von Dividenden und Managerboni und der Durchführung von Aktienrückkaufprogrammen bei Unternehmen, deren Lohnzahlungen durch das Kurzarbeiter*innengeld finanziert werden. So könnte der Transfer öffentlicher Gelder in die Taschen der Aktionär*innen und Manager*innen ohne großen Aufwand verhindert werden.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.