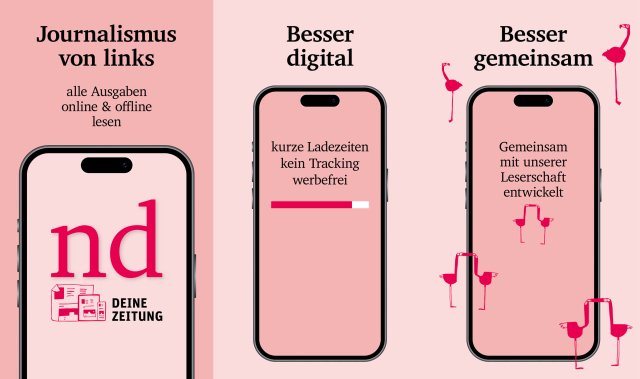- Politik
- Wahlrechtsgesetz
Klage gegen Bundestagswahlrecht: Zur Not macht’s Gysi alleine
CSU und Linke wehren sich in Karlsruhe gegen das neue Bundestagswahlrecht

Wenn man Gregor Gysi nach der Reform des Wahlrechts fragt, kommt er schnell in Fahrt. Unmöglich findet er, dass die Ampel-Parteien sich bei der Gelegenheit eines Teils der unliebsamen Opposition entledigen wollten, schimpft er, wo immer er Gelegenheit hat. Man darf ihm abnehmen, dass er sich einerseits aus grundsätzlichen demokratischen Erwägungen aufregt. Andererseits schwebt das reformierte Gesetz wie ein Damoklesschwert über seiner Partei, der Linken. Denn die müsste sich unter den veränderten Bedingungen noch mehr anstrengen als ohnehin, wieder in den Bundestag einzuziehen. Noch einmal mit weniger als fünf Prozent, aber mit drei Direktmandaten – das ginge künftig nicht mehr.
Der Konjunktiv ist angebracht, denn ob das Gesetz wirklich in der Form kommt, wie es die Ampel im März 2023 beschlossen hat, ist ungewiss. Das Bundesverfassungsgericht verhandelte nun zwei Tage lang über Beschwerden, die von der bayerischen Landesregierung, der Unionsfraktion im Bundestag, der Linkspartei und über 4000 Einzelpersonen eingereicht wurden. Letztere werden in Karlsruhe vom Verein Mehr Demokratie vertreten. Gysi ist dabei – als Prozessbevollmächtigter der Linken und als Rechtsvertreter mehrerer Einzelkläger.
Dabei gibt es gute Gründe, das Wahlrecht zu überarbeiten, die niemand bestreitet. Denn die Mischung aus Mehrheits- und Verhältniswahlrecht hat ihre Tücken. Das oberste deutsche Parlament wird immer größer und teurer. Im Idealfall sollten es 598 Abgeordnete sein; es gibt 299 Bundestagswahlkreise, aus jedem kommt ein direkt gewählter Abgeordneter, und genau so viele Kandidaten ziehen über die Landeslisten der Parteien ein. Freilich hat das nie so genau hingehauen. Seit 1990 pendelte die Größe des Bundestags bis 2017 zwischen 603 und 672 Mandaten – weil mal diese, mal jene Partei in einem Bundesland per Erststimme mehr Mandate gewinnt, als ihr nach Zweit-, also Listenstimmen zustehen würden. Diese Überhangmandate werden für die anderen Parteien ausgeglichen, damit die Proportionen nicht verzerrt werden.
Unübersichtlich wurde es ab 2017, als die AfD in den Bundestag einzog und die Differenz zwischen Direktmandaten und Zweitstimmenergebnissen wuchs. Der Bundestag explodierte – 2021 waren es 734 Abgeordnete. Im Plenarsaal wurde es eng. Zuweilen gingen Prognosen sogar von mehr als 800 Abgeordneten aus.
Diese Gigantisierung will die Politik stoppen. Der Kern des neuen Wahlgesetzes: Die Parteien bekommen nur so viele Sitze, wie ihnen nach Listenstimmen zustehen. Das heißt: Gewinnt eine Partei überproportional viele Direktmandate, ziehen dennoch nicht alle Wahlkreissieger ins Parlament ein. Die direkt Gewählten mit den schwächsten Ergebnissen fallen raus. Und: Die sogenannte Grundmandatsklausel, wonach eine Partei mit mindestens drei Direktmandaten auch dann ihrem Zweitstimmenergebnis entsprechend in den Bundestag einzieht, wenn sie unter der Fünf-Prozent-Grenze bleibt, ist gestrichen. Ins Parlament kommen nur noch Abgeordnete, deren Partei mindestens fünf Prozent erreicht.
Gegen die Neuregelungen wurde mehrfach geklagt. Die Linke wäre demnach bei der letzten Wahl mit 4,9 Prozent komplett gescheitert. Die nur in Bayern kandidierende CSU hatte – auf den Bund hochgerechnet – 5,2 Prozent. Etwas weniger, und ihre 45 Direktmandate wären wertlos.

Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.
Das bringt die CSU auf die Palme. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat den »Eindruck, dass einzelne Parteien das Wahlrecht zu ihren Gunsten gestalten können«. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz sprach von einem »problematischen Systemwechsel hin zu einem reinen Verhältniswahlrecht«. Und CSU-Abgeordneter Michael Frieser, der auch als Justiziar der Unionsfraktion im Bundestag fungiert, wittert eine Wettbewerbsverzerrung.
Kaum verwunderlich, dass die Bundesregierung das anders sieht. So sagte in Karlsruhe die Bevollmächtigte der Bundesregierung, Sophie Schönberger, eine Ungleichheit sei nicht erkennbar, wenn Parteien nach dem Zweitstimmenergebnis beurteilt werden. Und der Bevollmächtigte des Bundestags, Christoph Möllers, fügte hinzu, Wahlkreise seien »keine kleinen politischen Gemeinschaften«, Abgeordnete seien Vertreter des ganzen Volkes.
Dem widerspricht Gregor Gysi vehement und befindet sich damit in einer punktuellen und seltenen Übereinstimmung mit der CSU. Die Mehrheit des Bundestags wolle mit dem Wahlrecht zwei Parteien rausdrängen, sagte er vor den Verhandlungen; die neuen Bestimmungen seien durchaus ein Eingriff in die Chancengleichheit. Er bezeichnete die Fünf-Prozent-Hürde und die Drei-Mandate-Regel als »kommunizierende Röhren«. Wenn man die Grundmandatsklausel abschaffe, müsse man gleichzeitig die Fünf-Prozent-Hürde senken, um kleinere Parteien nicht zu benachteiligen.
Als Ungleichbehandlung kritisiert Gysi, dass ein unabhängiger Einzelbewerber, der einen Wahlkreis gewinnt, sein Mandat wahrnehmen darf, während ein Wahlkreissieger, dessen Partei unter fünf Prozent bleibt, nicht in den Bundestag kommt. Bleibe es dabei, werde er eben bei der nächsten Wahl als Unabhängiger antreten, kündigte Gysi an, der seit 1990 immer ein Direktmandat gewann. Ganz auf einer Linie mit der Union liegt er übrigens nicht. Er kritisierte deren Gegenvorschlag, die Grundmandatsklausel von drei auf fünf Direktmandate zu erhöhen – für die CSU kein Problem, für Die Linke durchaus.
Eine Entscheidung aus Karlsruhe wird in einigen Monaten erwartet, frühestens Ende Mai. Wenn das Bundesverfassungsgericht Änderungen am Gesetz verlangt, wird die Zeit knapp. Denn laut Bundeswahlgesetz dürfen frühestens 32 Monate nach Beginn der Wahlperiode Bewerber für die nächste Wahl aufgestellt werden. Sogar schon nach 29 Monaten dürfen in den Parteien Wahlen für die Vertreterversammlungen stattfinden – also für jene Gremien, die dann die Landeslisten beschließen. Die jetzige Wahlperiode begann 26. Oktober 2021. Das heißt, es müsste sehr schnell alles geregelt sein, damit die Rechtsgrundlagen klar sind. Zumal bei einer neuen Gesetzesfassung auch mit neuen Klagen zu rechnen ist. Nicht ausgeschlossen also, dass der nächste Bundestag noch einmal nach den alten Regeln gewählt wird. Und vielleicht erneut mit Rekorddimensionen. Mit Agenturen

Wir behalten den Überblick!
Mit unserem Digital-Aktionsabo kannst Du alle Ausgaben von »nd« digital (nd.App oder nd.Epaper) für wenig Geld zu Hause oder unterwegs lesen.
Jetzt abonnieren!
Linken, unabhängigen Journalismus stärken!
Mehr und mehr Menschen lesen digital und sehr gern kostenfrei. Wir stehen mit unserem freiwilligen Bezahlmodell dafür ein, dass uns auch diejenigen lesen können, deren Einkommen für ein Abonnement nicht ausreicht. Damit wir weiterhin Journalismus mit dem Anspruch machen können, marginalisierte Stimmen zu Wort kommen zu lassen, Themen zu recherchieren, die in den großen bürgerlichen Medien nicht vor- oder zu kurz kommen, und aktuelle Themen aus linker Perspektive zu beleuchten, brauchen wir eure Unterstützung.
Hilf mit bei einer solidarischen Finanzierung und unterstütze das »nd« mit einem Beitrag deiner Wahl.