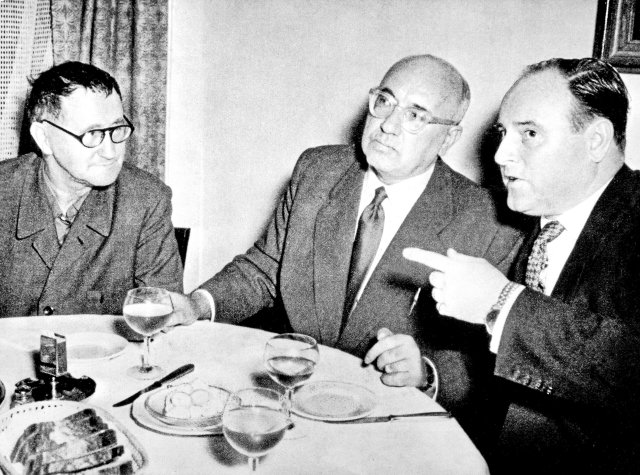- Kultur
- Tiervideos und Petfluencer
Herzensbildung – Bruder Bär
Tiervideos im Internet machen uns zu besseren Menschen

Tiervideos doof zu finden, ist der billigste Sport seit Erfindung des Internets. Zigmillionenfach werden sie auf Youtube geklickt oder als Instagram-Reels hin und her geschickt. Viele von ihnen sind banal bis scheiße, unglaublich viele bilden das Elend unverstandener Haustiere ab, werden aber wahnsinnig süß gefunden. Hunderttausende superbeknackter Kommentare bilden wiederum die Doofheit der Menschen ab, die in Tieren so etwas wie menschliche Babys erkennen und jeden Ausdruck und jede Handlung ihres Kätzchens oder ihres Qualzucht-Hundes als putzige Lebensäußerung behandeln, gern auch unter der Prämisse: Wauzi liebe ja Herrchen und Frauchen so dolle.
Vieles davon ist eine Pest.
Und dann sind da diese Momente. Diese kurzen Videos, wenige Sekunden oft nur, die alles infrage stellen. Die uns anrühren. Begeistern. Und die uns nachdenklicher machen als die letzten Gegenwartsromane, Bundesligaresultate, Tarifverhandlungen.
Ein Mann und ein Schimpanse laufen durch ein Zoogelände mit Klettergerüst. Mit Leichtigkeit kraxelt der Schimpanse hoch. Dann dreht er sich um, zieht den Mann hoch, will oben weiterlatschen, dreht sich aber noch mal um. Und Mann und Schimpanse klatschen sich ab, Faust gegen Faust, wie echte Kumpels, Fistbump!
Irgendwo im Wald. Der Kojote wartet auf seinen Freund, den Dachs. Dann erst gehen sie gemeinsam durch den Tunnel.
Ein Reiher steht beschäftigungslos an einem Ufer. Neben ihm hupft und zappelt ein Fisch, der das Wasser vermisst. Ein paar Sekunden sieht der Reiher sich das an. Dann packt er den Fisch mit dem Schnabel und bringt ihn ein paar Meter nach vorne, dorthin, wo das Wasser tiefer ist. Da schwimmt der Fisch fort.
(Nein, das sind alles keine KI-generierten Filmchen, die gibt es in letzter Zeit auch, aber diese hier sind alle älter.)
Ein Huhn und ein Hund jagen sich um einen großen Holzstapel herum, linksrum, rechtsrum, abwarten, der Hund das Huhn, das Huhn den Hund. Die beiden haben den Spaß ihres Lebens.
In der Arktis tuckern ein paar dick eingepackte Forschende mit ihrem kleinen Motorschiff zwischen imposanten Eisbergen entlang, da taucht seitschiffs ein Belugawal auf, das ist so eine Art weißer Delfin mit kurzer Schnauze. Es gibt eine kurze Kommunikation zwischen einem der Forschenden an Deck und dem Wal. Der Mann lässt sich einen Football geben, warum auch immer der an Bord ist. Dann macht er, was man mit einem Football halt macht: wirft ihn, so weit er kann, aufs arktische Meer hinaus. Und der Beluga macht, was ein jeder Terrier tun würde: rast los. Um den Ball zu holen. Elegant und superschnell erreicht er den Ball, holt ihn, schwimmt damit zum Boot, das sich in voller Fahrt befindet. Dann überreicht er den Football. Damit der gleich wieder geworfen wird.
Können Tiere unsere Freunde sein?
Tiere sind Dinge. Das zu glauben, ist eine Geschäftsgrundlage unserer erfolgreichen Zivilisationen. Tiere als Rohmasse zu behandeln, als Nahrungsmittel auf Beinen, als Transportmittel, das mit Hafer betrieben wird. Hunderte von Millionen von Tieren sind in engen Ställen und Käfigen gehalten worden, um dann, wenn sie reif waren, geschlachtet zu werden; und über Jahrtausende haben ihre Wächter es vermieden, ihnen in die Augen zu sehen. Manche Tiere wurden zu Gefährten gemacht, eher zwangsweise wie die Hauskatzen, oder sie fügen sich willig ein in ein Rudel aus seltsamen Zweibeinern, wie die Hunde.
Fragt man die Besitzer oder Rudelgenossen solcher Haustiere, so herrscht kein Zweifel. Dass sie Gefühle haben. Treu und voll überschwänglicher Liebe die einen, wahre Freunde; eher divenhaft die anderen, doch zweifellos von Charakter. Dass man mühelos ein kleines Ferkel zu einem ebenso treuen, liebevollen, verspielten Hausgenossen machen kann wie einen Hund – besser nicht drüber nachdenken.
Nun ist das Nachdenken eh nicht unsere starke Seite. Dem Menschen ist es ohne Weiteres möglich, Informationen bei Bedarf an- und dann wieder auszuknipsen. Etwa bin ich neulich gefragt worden, ob ich Fleisch esse, und ich konnte in aller Widersprüchlichkeit bekennen: Ich würde jedes Gesetz sofort unterschreiben, das Massentierhaltung verbietet und Fleischkonsum unter Strafe stellt. Wenn ich jedoch auf ein paar fränkische Rostbratwürste mit Kartoffelstampf und Sauerkraut eingeladen werde, kann ich nicht Nein sagen. Die Massentierhaltung und das Mordgeschäft der Schlachthöfe, die fernab unserer Wohnhäuser stattfinden, erlauben es uns, die Wurst als ein eigenes Ding zu denken. Wir haben das Schwein, das wir kauen, nie kennengelernt.
Die Menschheit hat es so weit gebracht – mit acht Milliarden Individuen, mit weitestgehender Unterwerfung, Umformung und Nutzbarmachung des Planeten –, indem sie sich eingeredet hat: Das ist okay so. Das sagt ja schon die Bibel, dass wir uns den ganzen Kram untertan machen sollen. Das sagt ja schon seit Descartes die Wissenschaft, dass Tiere biologische Apparate sind, unserem Nutzungswillen unterworfen wie Uhr, Webstuhl und Mähdrescher.
Wir spüren aber, dass es nicht stimmt. Philosophen und Naturwissenschaftler haben alles Denkbare unternommen, um einen Trennstrich zu ziehen zwischen uns und den anderen Tieren. Man hat ihre Denkfähigkeit herangezogen, die unserer nicht vergleichbar sei. Man hat das Konzept »Bewusstsein« herangezogen, ohne es je definieren oder für Tiere ausschließen zu können. Münder kluger Menschen haben sich fusselig geredet, um der Erkenntnis von der Schippe zu springen: Die da, die anderen Säuger, sie könnten unsere Freunde sein. Wir können uns einfühlen in sie. Sie als Nahrungsmittel zu behandeln, sie einzubunkern, mit Medikamenten vollzustopfen, sie zu töten, ist unrecht.
Warum denn auch soll Denkfähigkeit oder ein ausgeprägtes Selbst-Bewusstsein der Joker gegen Objektifizierung und Grausamkeit sein? Sollte es nicht um die Leidensfähigkeit eines Lebewesens gehen? Wenn es unsere Entscheidung ist, ihm das Leid zuzufügen oder zu ersparen? Sagt nicht eine leise Stimme in uns, dass die anderen Säuger unsere Verwandten sind und unseren Respekt verdienen? Soll man als Mensch auf ewig seine Empathie leugnen, begraben und verschweigen?
In einem äußerst beliebten Video einer nächtlichen Wald-Überwachungskamera sieht man einen Kojoten und einen Dachs gemeinsam umherstrolchen. Sie sind ganz klar als Kumpels unterwegs. Sie kommen an eine Betonröhre, die als Tunnel dient. Der Kojote war mit seinen langen Beinen etwas schneller, er wartet aber auf den Dachs. Zusammen gehen sie durch die Röhre.
Ein Eichhörnchen hinterlegt vor der Haustür einen Keks für die Frau, die dem Eichhörnchen immer Nüsse bringt.
In einem Zoo in Belgien sind die Orang-Utans depressiv geworden, wegen der Pandemie. Ihnen fehlt die tägliche Unterhaltung durch die Besucherscharen. Darauf öffnet ein kluger Mitarbeiter das Orang-Utan-Gehege für die Otter, die nebenan wohnen. Die Otter haben einen Riesenspaß, tollen umher, und sie freunden sich mit den Orang-Utans an, bei denen sofort wieder die Lebensfreude einkehrt.
Eine Taucherin in der Karibik hilft Haien, die unter Wasser zu ihr kommen: Die Haie haben fette Anglerhaken im Maul stecken. Sie kommen zu der Taucherin und sperren ihr Haifischmaul auf, bis die Anglerin die Haken rausgedreht und entfernt hat. Die Praxis wird seit vielen Jahren regelmäßig besucht.
Freundschaft, was ist das? Vertrauen, was ist das? Muss man dafür besonders intelligent sein? Können wir bei unseren Menschenfreunden genau erklären, warum wir sie in unser Herz lassen und andere nicht? Ist die beste Freundschaft nicht die, wo man zusammen schweigen kann und sich an der Nähe des anderen Säugetiers erfreut und wo Intellekt und Ich-Bewusstein gar nicht so furchtbar wichtig sind?
Können Tiere Freunde sein? Tiere unterschiedlicher Arten?
Der Wissenschaft wäre es lieber gewesen, wenn so etwas nicht vorkäme, denn welcher evolutionäre Vorteil lässt sich da hineininterpretieren? In einer einfach aufgelösten Welt halten nur die eng Verwandten zusammen, also Tiere einer Art, besser noch: direkte Familienangehörige.
Dass es diese Freundschaften über Artgrenzen hinweg gibt, hat man nicht leugnen können, denn zu oft kann es beobachtet werden – in den Wohnungen, wo Hund und Katz zusammen aufwachsen; auf den Bauernhöfen, wo die Pferde sich freuen, wenn eine Ziege mit im Stall steht. Also wird gern die Ausrede gezückt: So etwas Unnatürliches geschehe ja nur bei domestizierten Tieren.
Tut es aber nicht. Schimpansen und Gorillas können stabile Freundschaften bilden, und das in freier Wildbahn und trotz Nahrungskonkurrenz. Zebras und Strauße finden gern zusammen. Patchworkfamilien verschiedener Vogelarten sind beobachtet worden. Ein recht berühmt gewordener kalifornischer Esel namens Diesel hat sich vor einigen Jahren einer Herde von Wapiti-Hirschen angeschlossen, die ihm gegenüber eine vorbildliche Toleranz und Offenheit beweisen.
Als Vertreter der Spezies Menschen hat man diese Dinge lange nicht wissen wollen. Praktischer war ja immer die Weisung: Du bist Gottes Lieblingskreatur und kannst frei schalten und walten. Du sollst dir keinen Kopp machen!
Und, ja, man soll Tiere nicht vermenschlichen. Umgekehrt aber ist es auch nicht sinnvoll, den Menschen zu entsäugetieren. Einige unserer edelsten Regungen sind vielleicht gar nicht so exklusiv, wie wir es der Einfachheit halber, und weil die Rostbratwürstchen so lecker sind, gern hätten. Ein anderes Tier anzuschauen mit einer Mischung aus Neugier, Wachsamkeit und Sympathie – ist das vielleicht sehr tief drin in uns Säugern? Auch wenn wir die meiste Zeit mit Überlebenskampf beschäftigt sind und es nur selten zeigen können? Und was folgt daraus für unser Verhalten gegenüber den Tieren?
Mein bester Freund im Netz ist seit einiger Zeit ein Bär. Der Bär ist in einem Tiervideo zu sehen, keine Minute lang. Irgendwo in Kanada oder so trottet er eine einsame Landstraße entlang; neben der Straße befindet sich ein spitzes hellrotes Hütchen zur Straßenrandmarkierung. Das Hütchen ist aber umgefallen. Der Bär auf seinem Weg erkennt, dass hier etwas nicht in Ordnung ist. Mit Tatze und Kopf kippt er das Hütchen wieder in die Aufrechte, gibt ihm einen ganzen zarten letzten Stups mit der Schnauze, damit es stehen bleibt. Dann ist das geregelt. Der Bär geht wieder seiner Bärenwege. Wer kann ihm die Zuneigung versagen?
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.