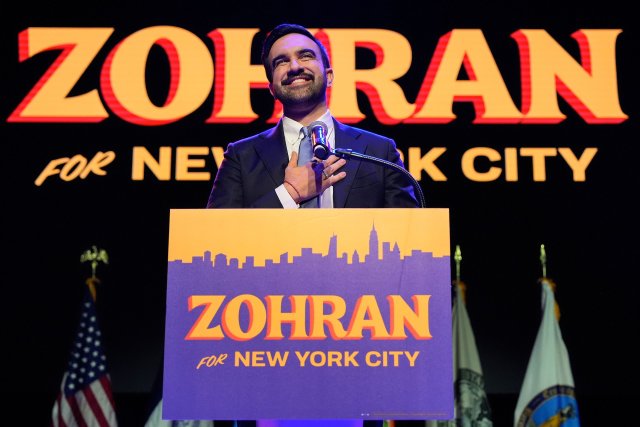- Politik
- Familienpolitik
»Ältere Wählergruppen dominieren die Politik«
Was geschieht, wenn der Staat die Familien vernachlässigt? Darüber denkt der Soziologe Stefan Schulz nach und schlägt eine Änderung des Wahlrechts vor

Die neue Bundesregierung unterstützt massiv die Unternehmen, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Wird davon bei den Familien etwas ankommen?
Wohl eher wenig. Friedrich Merz setzt vor allem auf zwei Themen, die er für wichtig hält: Wehrfähigkeit und Infrastruktur. Ich befürchte, dass die Bundesregierung die Sondervermögen, die dafür zur Verfügung stehen, anderswo einsparen wird – vermutlich mit harten Streichungen beim Sozialen, was zulasten der Familien gehen wird. Dabei sind sie der soziale Kern jeder Gesellschaft. Werden sie vernachlässigt, dann hat das tiefgreifende Folgen. In der Geschichte – selbst unter den menschenverachtendsten Regimen – war Familienpolitik stets ein strategisches Anliegen. Derzeit jedoch sinkt das Ansehen der Familien – nicht nur Regierungen, sondern auch viele Menschen empfinden Familie als Zumutung.
Woran liegt das? Sie schreiben in ihrem jüngsten Buch »Die Kinderwüste«, viele Menschen geben ihren Kinderwunsch eher aus Anpassung an schwierige Rahmenbedingungen auf als aus echter Überzeugung. Was finden Sie bemerkenswerter: einen klar geäußerten Kinderwunsch oder eine völlige Ablehnung von Kindern?
Solche Aussagen resultieren oft aus einer momentanen Stimmungslage heraus. Ich bin Soziologe und schaue auf die Zahlen: In Deutschland kristallisiert sich der Kinderwunsch meistens zwischen 29 und 31 Jahren heraus, scheitert aber häufig an volkswirtschaftlichen Gegebenheiten: fehlende bezahlbare Wohnungen, mangelnde Jobsicherheit und unzureichende staatliche Unterstützung. In Berlin etwa liegt die Geburtenrate bei rund 1,1 Kindern pro Frau. Zwei Menschen bringen also statistisch betrachtet nur noch ein Kind zur Welt, was innerhalb einer Generation zu einer Halbierung der Bevölkerung führen kann.
Macht sich das schon bemerkbar?
In manchen ostdeutschen Dörfern kann man die demografischen Verwerfungen bereits hautnah erleben: Selbst ein Auto mit einem Kennzeichen aus dem Nachbarkreis wirkt dort fremd. Viele Bewohner leben dort seit Jahrzehnten und altern nun im Gleichschritt – ihre Kinder sind längst weg, niemand hilft beim Treppensteigen. Zurück bleiben ganze Straßenzüge, in denen keine Kinder mehr leben.

Stefan Schulz ist Soziologe und Podcaster. Schwerpunkt seiner Forschung sind Demografie (»Die Altenrepublik«, Hoffmann und Campe, 2022) sowie die Veränderung der Medienlandschaft (»Redaktionsschluss«, Hanser-Verlag, 2016). Sein Buch »Die Kinderwüste« ist in diesem Monat erschienen. Schulz ist Vater dreier Kinder und lebt in Frankfurt am Main.
Was ist zu tun? Eine Erkenntnis Ihres Buches lautet: Gegen Armut hilft Geld. Wie sollten Familien besser unterstützt werden?
Familienpolitik braucht kein kompliziertes Programm – Eltern wissen, was ihre Kinder brauchen. Studien wie die von Bertelsmann zeigen, dass zusätzliches Geld nicht für Konsumgüter oder Luxus ausgegeben wird, sondern direkt den Kindern zugutekommt. Gerade Alleinerziehende, die oft in prekären Berufen arbeiten, erleben das unmittelbar: Wenn man mit 1000 Euro auskommen muss und der Staat 400 Euro fürs Kind gibt, wird dieses Geld in Bildung, Ernährung oder Freizeit investiert – aber sicher nicht in einen neuen Fernseher oder Zigaretten. Dieses Klischee hält sich hartnäckig, entspricht aber nicht der Realität.
Sie schreiben, dass sich Aufwendungen in die Bildung kräftig auszahlen.
Die Zahlen sind gigantisch. Eine Investition in Bildung – als integraler Pfeiler unseres volkswirtschaftlichen Systems – erreicht nach elf Jahren einen Return on Investment von etwa 14 Prozent. Das heißt, dass jeder investierte Euro in Bildung nach elf Jahren einen Mehrwert von 14 Cent pro Jahr generiert. Diese Zahlen stammen vom Wirtschaftswissenschaftler Tom Krebs. Dieser gesamtwirtschaftliche Ertrag übertrifft die individuellen Renditen klassischer Anlagen, die typischerweise zwischen drei und sieben Prozent liegen.
Die Berechnung klingt eindrucksvoll. Trotzdem passiert nur wenig – warum?
Anstatt massiv in institutionelle Bildung und Betreuung zu investieren, erleben wir schon seit Längerem eine Rückkehr überholter Rollenvorstellungen: Familien – meist Frauen – sollen die gesamte Care-Arbeit übernehmen, also den Haushalt machen, Kinder betreuen, Angehörige pflegen. Der politische Fokus auf Verteidigung wird dieses Phänomen verstärken. Die Erwerbsarbeit bleibt bei Frauen auf der Strecke, gleichzeitig steigt der soziale Druck. Familie war stets an eine zentrale Aufgabe geknüpft – die nächste Generation musste bereitstehen, sei es für den Hof, das Handwerk oder die Gesellschaft. Familie ist elementar für jede Gesellschaft, und ihre Vernachlässigung hat tiefgreifende Folgen.
Eine davon ist der bereits beschriebene demografische Wandel. Aber es wird auch versucht, Jugendliche schon früher ans Erwerbsleben heranzuführen – beispielsweise durch die Streichung des 13. Schuljahres oder eine frühere Einschulung. Ist das eine gute Idee?
Nein. Die Entwicklung von Jugendlichen braucht Zeit. Ein gutes Beispiel ist das Jahr 2015, als viele syrische Familien nach Deutschland geflüchtet sind. Ein damals zehnjähriges Kind ist heute 20 Jahre alt und steckt mitten in der Ausbildung oder ist bereits Fachkraft. Kein Arbeitgeber oder Professor fragt dann ernsthaft: »Woher kommst du?« – sondern es zählt nur, dass jemand qualifiziert ist.
Insbesondere Migrant*innen empfinden es allerdings als befremdlich, wenn sie primär als wirtschaftliche Kategorie gedacht werden. Sie argumentieren ähnlich, wenn Sie von Kindern als »Humankapital« sprechen. Können Sie die Irritation nachvollziehen?
Ich betrachte das recht nüchtern: Wirtschaft und Gesellschaft lassen sich nicht voneinander trennen. Im Prinzip gilt für alle: Je besser Menschen ausgebildet sind und je freier sie über ihr Leben entscheiden können, desto mehr profitieren sie – Eltern, Kinder, Arbeitnehmer, der Staat. Warum sollten Menschen mit 65 Jahren automatisch in Rente gehen? Warum nicht flexiblere Arbeitszeiten? Ein System mit individuellen Spielräumen stärkt nicht nur die Wirtschaft, sondern auch das gesellschaftliche Miteinander. Gleichzeitig müssen wir den volkswirtschaftlichen Blick schärfen – wenn wir über Wirtschaft sprechen, sollten wir auch fragen: Wie gut sind die Schulnoten des neuen Jahrgangs? Welche Perspektiven haben Familien? Das gehört genauso zur Debatte. Ein Wirtschaftsmodell, das nur auf Unternehmensgewinne schaut und Familien ignoriert, ist unvollständig.
Viele junge Menschen sehen sich gerade mit einem Szenario konfrontiert, das ihre Lebensplanung empfindlich beeinträchtigen könnte – wenn sie eventuell wieder zur Bundeswehr müssen. Glauben Sie an eine Rückkehr zur Wehrpflicht?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es zu einer allgemeinen Musterung kommt – geschweige denn zu einer Wehrpflicht. Die CDU hat bereits gesagt, sie will nicht alle verpflichten, sondern nur die Besten. Viel Spaß dabei! Dann müssen wir über äußere Feinde gar nicht mehr sprechen, weil die Spaltung im Inneren so groß wäre. Eltern, die jahrelang alles für ihre Kinder getan haben – Sportverein, gute Bildung, Förderung –, sollen dann akzeptieren, dass genau diese Kinder in die Kasernen gesteckt werden, weil sie in den Tests so gut abgeschnitten haben? Das machen die nicht mit.
Ist die Frage nach der Wehrpflicht also überflüssig?
Komplett. Diese Russland-greift-uns-an-Erzählung ist eine virtuelle Debatte. Ich denke, solange die Bedrohung nicht real im Alltag auftaucht, bleibt sie abstrakt und sollte auch keine Relevanz im Alltag haben.
Ein wichtiges Instrument, um Familien wieder in den Fokus der Politik zu rücken, ist aus Ihrer Sicht ein Familienwahlrecht: Eltern wählen für ihre noch nicht-wahlberechtigten Kinder mit. Angenommen, Ihre älteste Tochter möchte ihre Stimme der AfD geben: Würden Sie sich dem beugen?
Natürlich würde ich mit ihr darüber diskutieren – so wie über alles andere auch. Ein Familienwahlrecht würde Eltern nicht zu bloßen Stellvertretern machen, sondern könnte politische Verantwortung dort stärken, wo sie ohnehin täglich übernommen wird. Heute dominieren ältere Wählergruppen die Politik: Die größte Wählerkohorte ist die der über 70-Jährigen, die am stärksten wachsende die der über 60-Jährigen. Erhielten Kinder ein Wahlrecht – mit Eltern als Treuhändern –, würde sich dieser Fokus verschieben. Plötzlich wären junge Eltern mit den Stimmen ihrer Kinder die einflussreichste Wählergruppe. Das würde Wahlkämpfe grundlegend verändern.
Ist politische Mündigkeit nicht eine Frage der Reife?
Aber wer legt diese Reife denn fest? In Deutschland kann jeder wählen – auch demenzkranke Straftäter. Aber ein 16-Jähriger, der im Unterricht Politik diskutiert und Perspektiven anderer hört, soll keine Stimme haben? Gleichzeitig kann ein 70-Jähriger, der sich täglich zehn Stunden in Telegram-Verschwörungsgruppen verliert, problemlos seine Stimme abgeben. Ich will niemandem das Wahlrecht nehmen, sondern es konsequent ausweiten.
Wie soll das gehen?
Eltern könnten die Stimme ihrer Kinder wie jede andere Verantwortung übernehmen – genauso, wie sie Kindergeld verwalten. Dass unser Wahlsystem komplexe Stimmverrechnungen zulässt, aber Kinder systematisch ausschließt, zeigt nur, wie dringend diese Debatte geführt werden muss.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.