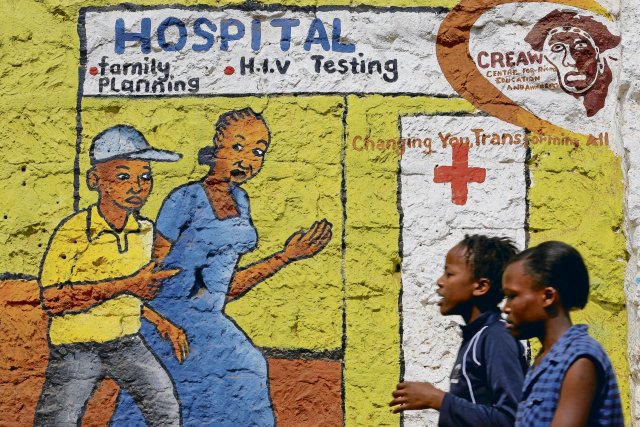- Wirtschaft und Umwelt
- Rohstoffe
Langer Weg zum Ölausstieg
Ölkartell Opec+ will mit Förderausweitung sinkenden Marktanteilen entgegenwirken

Vor dem Urlaubsparadies Usedom entdeckte kürzlich ein kanadisches Unternehmen enorme Mengen an Öl und Gas. Ende Juli machte Central European Petroleum (CEP) seinen Fund in der Ostsee öffentlich. In nur neun Meter Wassertiefe und in Sichtweite der Hafenstadt Świnoujście liegt das Ölfeld Wolin Ost, benannt nach der nahe gelegenen Insel. Ein »historischer Moment« für Polens Energiewirtschaft, lässt sich CEP-Chef Rolf G. Skaar in einer Pressemitteilung seines Unternehmens zitieren. Umweltschützer warnen hingegen vor einer Katastrophe.
Das Erdölzeitalter mag zu Ende gehen, doch bis dahin scheint es noch ein langer Weg zu sein. Die weltweite Ölnachfrage wird in diesem Jahr voraussichtlich um 720 000 Barrel (à 159 Liter) pro Tag steigen. So lautet die Schätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) in ihrem am Mittwoch in Paris veröffentlichten »Öl-Markt-Report«. Für das kommende Jahr erwartet die IEA ein weiteres Wachstum von 740 000 Barrel pro Tag. Ob es tatsächlich zu einer solchen Fördersteigerung von Erdöl und -gas kommt, hänge allerdings von der Entwicklung der Weltwirtschaft und dem Ausbau sauberer Energietechnologien ab.
Insgesamt förderte allein die Opec+ im Juni 42,8 Milliarden Barrel, nach knapp 42,3 Milliarden im Mai. Der Interessengemeinschaft gehören neben den traditionellen Mitgliedern der Organisation erdölexportierender Länder unter anderem auch Oman, Mexiko und Russland an. Russlands Rohöl- und Produktexporte sanken im Vergleich zum Vorjahr leicht. Allerdings liegen die Fördermengen mit monatlich 9,2 Milliarden Barrel nicht weit unterhalb der Kapazitätsgrenze von 9,8 Milliarden Barrel.
Stärker schlägt der Ölpreis durch. Mit dessen Rückgang sanken die Einnahmen Moskaus im Mai gegenüber dem Vormonat um 480 Millionen auf 12,6 Milliarden US-Dollar. Was einem Rückgang von 4,0 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Rohölexporteinnahmen im Mai erreichten damit den niedrigsten Stand seit Februar 2021. Seither steigt der Ölpreis weltweit wieder. Eine Folge vor allem der dramatischen Zuspitzung der Konflikte im Nahen Osten, der global immer noch wichtigsten Förderregion.
Die Internationale Energieagentur sieht solche Krisenherde mit Sorge, könnten sie doch den Ölpreis für den Globalen Norden rasant in die Höhe treiben. Ein Dutzend westlicher Industriestaaten hatte 1974 die IEA als Antwort der Käufer auf die damalige Ölkrise gegründet. Die Agentur verfügt sogar über erhebliche öffentliche Ölreserven, mit denen sie in den Markt eingreifen kann, was sie in der Vergangenheit auch getan hat. Zwischen der derzeitigen kritischen Energielage und den Ölpreisschocks der 70er Jahre gibt es zwar einige Parallelen, allerdings auch wichtige Unterschiede. So sind die Vereinigten Staaten seit Kurzem vom größten Käufer zum führenden Produzenten von Rohöl aufgestiegen.
Die erdölexportierenden Länder der Opec+ haben kürzlich angekündigt, die tägliche Fördermenge um 547 000 Barrel am Tag weiter zu erhöhen. Mit der Entscheidung von Anfang August setzt das Kartell eine Reihe von Förderausweitungen fort, mit denen im April begonnen wurde. Die neueste Änderung gilt ab September. Damit werden die seit 2023 bestehenden Kürzungen von insgesamt 2,2 Millionen Barrel pro Tag vollständig rückgängig gemacht.
Die Ankündigung kam überraschend. Branchenbeobachter sehen eigentlich keinen Bedarf für zusätzliches Öl, sondern die Möglichkeit einer Überversorgung, die auf die Preise drücken würde. Auch Saudi-Arabien und Russland, die die Allianz anführen, sollten vor allem an hohen Preisen interessiert sein. Jahrelang hatte die Opec+ die Produktion gedrosselt, um die Preise auf dem Weltmarkt zu stützen. Zur Begründung ihrer Kehrtwende nannte sie nun eine robuste Weltwirtschaft und (zu) niedrige Lagerbestände, was zu entsprechender Ölnachfrage führe.
Überzeugender scheint ein anderer Grund zu sein: Es geht um größere Marktanteile. Auf die zwölf Opec-Staaten und ihre sechs Verbündeten entfällt nur noch etwa die Hälfte des Ölmarktes. Sie verlieren seit Längerem Anteile an Produzenten außerhalb des Kartells, zum Beispiel an die USA. Wie sich Nachfrage und Ölpreis perspektivisch entwickeln, dürfte auch im Hinblick auf Drohungen von US-Präsident Donald Trump spannend bleiben, mit sogenannten Sekundärzöllen Länder zu bestrafen, die russisches Öl kaufen.
In die Spitze der Nicht-Opec-Staaten stößt derweil auch Brasilien vor. In den Küstengewässern vor Rio de Janeiro meldete British Petroleum (BP) vergangene Woche den größten Ölfund seit 25 Jahren. Der Konzern besitzt die alleinigen Nutzungsrechte an dem neuen Ölfeld, die es im Rahmen einer Auktion des Staates vor zwei Jahren ersteigert hatte.
Angesichts der veränderten klimapolitischen Großwetterlage seit dem Machtwechsel in Washington setzt BP wie andere Ölkonzerne, die zeitweilig viel in Erneuerbare investiert hatten, wieder stärker auf fossile Brennstoffe – um den Aktienkurs zu steigern und so die Investoren an der Börse bei Laune zu halten.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.