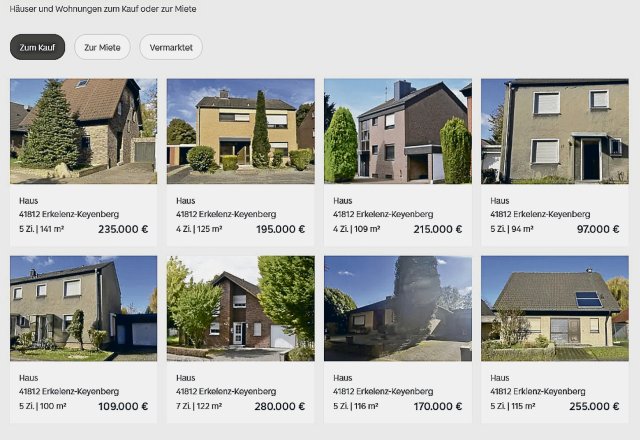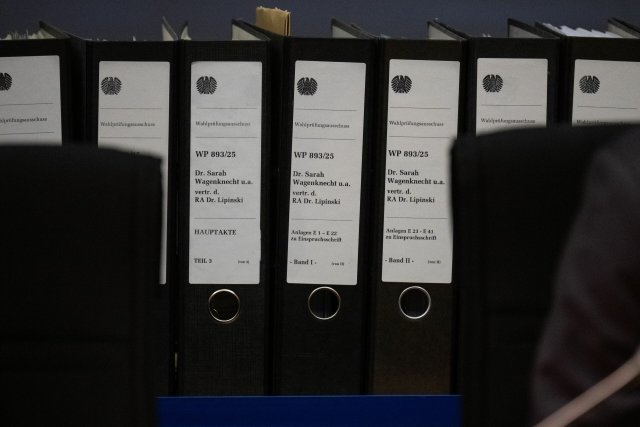- Politik
- Migrantische Arbeitskämpfe
Vom Bleiben, Gehen und Sprechen
In der deutschen Erntesaison sind Arbeitsrechtsverletzungen an der Tagesordnung. Im Jahr 2020 streikten rumänische Saisonarbeiter – mit Erfolg

Im Mai 2020, zu Beginn der Corona-Pandemie, legten die überwiegend rumänischen Saisonarbeitskräfte des Spargel- und Erdbeerhofs »Ritter« in Bornheim bei Bonn ihre Arbeit nieder. Nach mehreren Protestaktionen auf dem Hof und in Bonn entschloss sich ein Großteil der Belegschaft schließlich, Klage beim Arbeitsgericht einzureichen – und gewann.
Dieser Fall markiert einen Erfolg für die Arbeiter*innen, stellt aber gleichzeitig einen Sonderfall dar. Denn in der Regel folgen in derartigen Fällen keine Streiks oder Proteste – geschweige denn, dass sie vor Gericht verhandelt werden. Das System der Saisonarbeit in der Landwirtschaft ist von gravierenden Arbeitsrechtsverletzungen durchzogen. Gleichzeitig sehen sich die zumeist mobilen Beschäftigten enormen organisatorischen und sozialen Hürden gegenüber, sich gegen diese zu wehren. In der Regel bleiben rechtliche Reaktionen aus. Stattdessen reagieren die Arbeiter*innen meist mit anderen Strategien, die das Unrecht nicht direkt kritisieren, wie etwa den oder die Arbeitgeber*in zu wechseln.
Wie kommt es zu dieser Diskrepanz? Und welche Faktoren führten in diesem Fall dazu, dass die Saisonarbeiter*innen ihre Rechte trotzdem einklagten? Dies untersuchten wir anhand des strategischen Handelns der Saisonarbeiter*innen bei Spargel-Ritter – unter Verwendung der Kategorien Mobilität (»Loyalty« oder »Exit«) und Protestform (»Voice«).
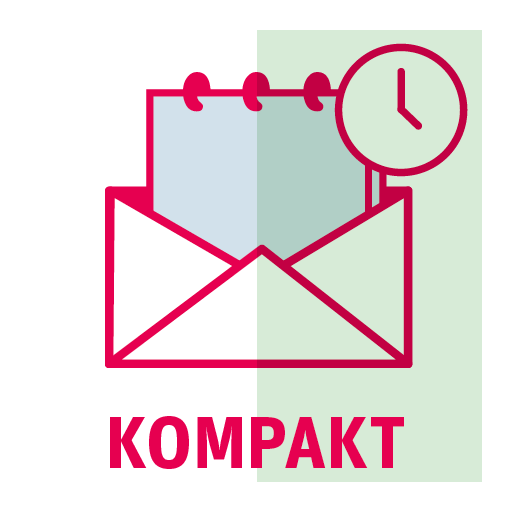
Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.
Strategisches Vorgehen
Loyalty ist eine Strategie des Bleibens und Wiederkommens von Beschäftigten, die meist mit der Hoffnung auf bekannte und dadurch einschätzbare Abläufe einhergeht – ein wichtiger Faktor für betriebliche Stabilität. Bei den Beschäftigten von Spargel Ritter war dies, wie in der Saisonarbeit im Allgemeinen, auch angesichts widrigster Bedingungen, die lange überwiegende Strategie.
Spargel Ritter war ein großes landwirtschaftliches Unternehmen mit bis zu 450 Arbeiter*innen, zum Großteil migrantische Saisonarbeiter*innen. Bei Ritter machen Saisonarbeiter*innen, wie auch sonst üblich, bis zu 51 Prozent der Belegschaften in landwirtschaftlichen Betrieben aus. Unter dem gestiegenen Druck der Lebensmittelmärkte sind geringe Produktionskosten, also niedrige Lohnkosten, essenziell für die Produzent*innen, um einen Gewinn erwirtschaften zu können.
Die kurzfristige und niedrigschwellige Saisonarbeit ist harte körperliche Arbeit, die migrantisiert und dabei strukturell stark abgewertet ist. Sie kann »attraktiv« sein für Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen und in Ländern mit niedrigerem Lohnniveau. Während des zeitlich stark beschränkten Arbeitseinsatzes werden nötige Reproduktion und die Mittel dazu auf ein absolutes Minimum reduziert, was sich häufig auch in einer gewissen Toleranz gegenüber prekären Bedingungen bei Unterbringung und Versorgung widerspiegelt.
Die Normalisierung von Arbeitsrechtsverletzungen schwächt das Unrechtsbewusstsein der Betroffenen und verringert die Motivation, sich gegen erlittenes Unrecht zu wehren. Rechtlich zeichnet »echte« Saisonarbeit aus, dass sie saisonal befristet sein muss. Das heißt, sie darf nur einmal im Jahr für höchstens 70 Tage und in der Regel nicht berufsmäßig ausgeübt werden. Nur diese Beschäftigungsform entbindet von der Pflicht zur Entrichtung von Sozialabgaben. Möchte eine Landwirtin eine Arbeiterin länger als 70 Tage beschäftigen, weiterbeschäftigen oder vor Ablauf eines Jahres wieder anstellen, müssen Sozialleistungen auch rückwirkend gezahlt werden.
Auch wenn kalkulierte Rechtsbrüche keine Seltenheit in der Saisonarbeit sind, so nahmen diese im Fall Spargel-Ritter doch besonders drastische Ausmaße an. In einem Gerichtsurteil gegen die Familie Ritter wurde festgestellt, dass im Betrieb Sozialleistungen systematisch unterschlagen wurden, indem hintereinander mehrere 70-Tage-Verträge für dieselben Arbeiter*innen ausgestellt wurden. Das Verfahren endete mit einer dreijährigen Haftstrafe und Nachzahlungen in Höhe von drei Millionen Euro.
Die Datenlage zur Saisonarbeit legt allerdings ein hohes Maß an Normalität ähnlich gelagerter Rechtsbrüche nahe, außerdem im Bereich der Entgeltansprüche, der Arbeitssicherheit, der Unter- oder Nichtdokumentierung von Arbeitsverhältnissen sowie der unzureichenden, fehlerhaften oder lückenhaft dokumentierten Arbeitszeit. Die Akzeptanz von Rechtsbrüchen wird vor allem durch sozialen Druck bis hin zur Kündigung hergestellt. Arbeiter*innen beklagen sogar körperliche Gewalt.
Exit, also das Fernbleiben von der Arbeit, das (vorzeitige) Verlassen des Betriebs oder die Androhung dessen, kann hohen Druck gegenüber dem Arbeitgeber aufbauen. So können Beschäftigte wirkliche Handlungsmacht entfalten. Freilich steht dem das finanzielle Risiko eines Lohnausfalls entgegen, das häufig gegen andere Strategien, vor allem der Loyalty, abgewogen werden muss. So auch im vorliegenden Fall.
Das Unternehmen Spargel Ritter war bereits 2019 schwer verschuldet gewesen und die Zollbehörde hatte wegen Unregelmäßigkeiten bei den Anstellungspapieren Untersuchungen eingeleitet. Vor der Erntesaison 2020 meldete Ritter schließlich Insolvenz an und ein Verwalter übernahm die Geschäfte. Die für die Ernte angeworbenen Arbeiter*innen, die 2020 vornehmlich aus Rumänien anreisten und von denen einige bereits mehrere Male auf dem Hof gearbeitet hatten, wurden über den Zustand des Betriebs nicht informiert. Ihnen war vertraglich eine dreimonatige Anstellung zugesichert worden. Sie rechneten mit etwa 1400 Euro pro Monat, abzüglich der Kosten für Unterkunft und Verpflegung.
Bis zum 18. Mai 2020 waren für die Saison allerdings noch keine Löhne ausbezahlt. Und an diesem Tag kündigte eine Familie rumänischer Arbeiter*innen an, den Hof aufgrund eines privaten Notfalls früher als vereinbart zu verlassen. Diesen Personen wurde nur etwa ein Zehntel des erwarteten Lohns ausgezahlt, worüber sie die anderen Arbeiter*innen informierten. Wegen dieser Informationen über die Insolvenz des Unternehmens entschloss sich ein Teil der Belegschaft dann, gegen eine geringe Entschädigung auf ihren Lohn zu verzichten und verschiedene Exit-Strategien einzusetzen: Heimreise oder Weitervermittlung an andere Betriebe.
Allerdings reagierten nicht alle Saisonarbeiter*innen auf die Information der ausbleibenden Löhne mit der Exit-Strategie. Etwa 20 Arbeiter*innen traten als direkte Reaktion beim Abreiseversuch spontan in den Streik. Der Insolvenzverwalter bot ihnen 100 bis 200 Euro pro Person an, was die Streikenden ablehnten. So weitete sich der Streik unter den rumänischen Arbeiter*innen aus und am 19. Mai hatten unter einer wachsenden öffentlichen Aufmerksamkeit bereits etwa 200 Personen die Arbeit niedergelegt. Hier war also der Exit einiger die unmittelbare Bedingung dafür, dass andere das Kampfmittel Voice einsetzten; die beiden scheinbar entgegengesetzten Strategien verschmolzen miteinander.
Die dritte und seltenste Kategorie in der Saisonarbeit ist die Voice-Strategie: sichtbarer Protest, Widerstand, Klage. Sie bedarf des höchsten Grades an kollektiver Koordination und Organisation unter den drei Strategien. Warum wurde sie in diesem Fall eingesetzt?
Kurzer Blick zurück: Der Kontakt zur Basisgewerkschaft FAU kam initial über eine Arbeiterin zustande, die Deutsch sprach, einen ihr bekannten lokalen Radiojournalisten kontaktierte und diesen über die Missstände und den Streik informierte. Der Beitrag wurde noch am selben Tag ausgestrahlt und erreichte auch Mitglieder der FAU Bonn, die umgehend den Kontakt zu den Arbeiter*innen auf dem Hof suchten und, auf Wunsch der Arbeiter*innen, einen Anwalt hinzuzogen. Die Streikenden wollten mit einem Protestmarsch zum Büro des zuständigen Insolvenzverwalters und vor das rumänische Konsulat in Bonn öffentliche Sichtbarkeit für das Unrecht generieren. Dieser Protest steigerte den Druck auf den Insolvenzverwalter, der die zunächst angedrohte Räumung der Unterkünfte unterließ und damit eine Hauptbedingung für den weiteren Einsatz der Voice-Strategien schuf.
Das System der Saisonarbeit in der Landwirtschaft ist von gravierenden Arbeitsrechtsverletzungen geprägt.
-
Druckmittel Öffentlichkeit
Üblicherweise haben Saisonarbeiter*innen aufgrund von Sprachbarrieren und mangelnden sozialen Netzwerken kaum oder gar keinen Zugang zur öffentlichen Sphäre des Aufnahmelandes. Dadurch ist ihnen auch die öffentliche Anprangerung von Missständen als Mittel weitgehend versperrt. Aufgrund des hohen medialen Interesses für die Landwirtschaft in der Pandemie änderte sich dies jedoch radikal. So konnte nicht nur öffentlicher Druck auf das Unternehmen aufgebaut, sondern auch zivilgesellschaftliche Unterstützung mobilisiert werden.
Die öffentliche Präsenz des Konflikts bildet eine zentrale Grundlage für die lokale Organisation, die essenziell war für die Vorbereitung und Planung der von der Mehrheit der Arbeiter*innen angestrebten Gerichtsprozesse, um den fehlenden Lohn einzuklagen. Kommunikation war aber nicht nur nach außen, sondern auch unter den Streikenden selbst ein zentraler Erfolgsfaktor. In den Unterkünften kam es, auch aufgrund des Leerlaufs infolge der unzureichenden Arbeitsplanung, zu intensivem Austausch zwischen den Beschäftigten und gemeinsamer Kritik der Missstände: fehlende Löhne, aber auch schlechtes Essen, beengte Unterkünfte und mangelnde Hygienemaßnahmen. Dies trug zur Entstehung einer sonst eher ungewöhnlichen Solidaritätskultur bei, die Grundbedingung für erfolgreiches kollektives Handeln ist.
Ein großer Teil der Arbeiter*innen hatte nach Rücksprachen untereinander, mit dem Anwalt und der FAU die Entscheidung getroffen, gerichtlich den Lohn einzufordern. Der bürokratische Aufwand einer solchen Klage ist allerdings enorm. Sammelklagen sind in Deutschland verboten. Jeder Fall muss individuell eingereicht und Prozesskostengelder dementsprechend pro Fall beantragt werden. Für die Überwindung der bürokratischen und organisatorischen Hürden waren hier zwei Faktoren ausschlaggebend: Zum einen investierten einige FAU-Gewerkschafter*innen Arbeit von einer Woche mit bis zu zwölf Stunden pro Tag, um die Fälle vorzubereiten. Zum anderen konnte das Containerdorf der Arbeiter*innen weiter als Unterkunft, aber auch als Organisationszentrale genutzt werden. Diese aufwändigen, spontanen Unterstützungsstrukturen waren zentral für den Erfolg des Streiks und des Gerichtsverfahrens. Nur mithilfe der Organisationsmacht der FAU und der anderen zivilgesellschaftlichen Unterstützer*innen konnte also die Voice-Strategie umgesetzt werden.
Schließlich reisten die Arbeiter*innen im Juni nach und nach ab. Parallel wurden über vierzig Einzelklagen für über hundert Arbeiter*innen über nicht gezahlte oder unvollständige Löhne beim Amtsgericht Bonn eingereicht. Im Rahmen dieser Verhandlungen wurde im Februar 2021 für alle Einzelfälle ein gemeinsamer Vergleich ausgehandelt: Der Insolvenzverwalter musste insgesamt über 120 000 Euro an die Arbeiter*innen auszahlen. Diese erhielten so zwar nur einen Bruchteil des ursprünglich zugesicherten Lohns – aber immerhin so viel, dass sie, ebenso sowie die Unterstützer*innen, zufrieden waren und die Klagen als Erfolg verbuchen konnten.
Janika Kuge lehrt und forscht an der Universität Frankfurt zu Geograpien des Rechts. Simon Schaupp leitet das Fachgebiet Digitalisierung der Arbeitswelt an der Technischen Universität Berlin.
Eine lange Fassung dieses Artikels erschien in: PROKLA 220: Arbeit. Raum. Kämpfe,
55. Jahrgang, Heft 3, September 2025,
Bertz + Fischer, 184 S., 15 €.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.