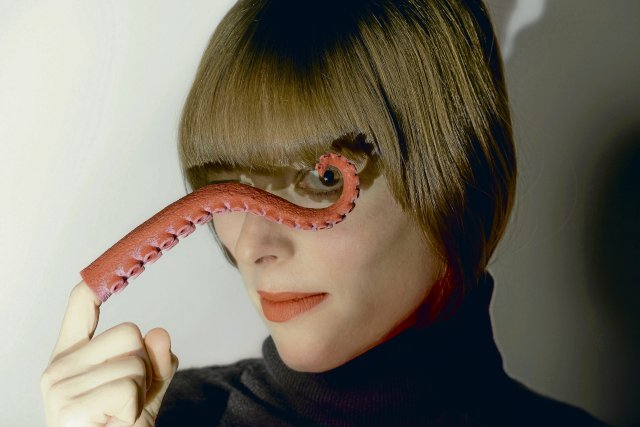- Kultur
- Musikfest Berlin
Wild bleiben
Das Musikfest Berlin hatte einen fulminanten Auftakt

Fortissimo-Klänge in D-Dur lassen den Beginn von Schuberts 10. Sinfonie erstrahlen, eine punktierte Figur, die wenig später die Klarinetten und in Folge die weiteren Holzblasinstrumente um die Dominante kreisen lässt. Später endet die Exposition in einigen A-Dur-Kadenzen, wir hören eine typisch sehnsuchtsvolle Schubert’sche Melodie wie in der »Unvollendeten«, das Tempo ist nicht mehr ein majestätisches Allegro, sondern ein Andante cantabile. Wir erleben einen feierlichen Posaunen-Choral, doch plötzlich, eingeleitet vom »himmlischen« Celesta, murmelnde Klangspuren, ins Nichts schwebende Sounds.
Franz Schubert hat in seinen letzten Lebenswochen an Skizzen zu einer großen D-Dur-Sinfonie gearbeitet. Im hinterlassenen Klaviersatz gibt es nur spärliche Angaben zur Instrumentierung, deutlich mehr melodische und harmonische Bausteine, dazu aber immer wieder: Lücken. Lücken, die die größeren formalen Zusammenhänge dieser Sinfonie nur erahnen lassen. Und diese Lücken hat der italienische Komponist Luciano Berio, der heuer 100 Jahre alt geworden wäre, mit einer Art Zement gefüllt, als eine »lontano« (entfernt) und »non cantare« (also ausdrücklich nicht gesungen) bezeichnete, zurückhaltende Klangfläche.
Berio hat mit seinem 1989 (die ersten beiden Sätze) von Nikolaus Harnoncourt und 1990 (finale Fassung mit 3. Satz) von Riccardo Chailly jeweils mit dem Royal Concertgebouw Orchestra uraufgeführten Werk »Rendering« eine Art Rekomposition geschaffen, indem er Schuberts Skizzen sorgfältig instrumentiert, vor allem aber fehlende Teile mit zeitgenössischen Traumsequenzen füllt: »Diese Restaurierung folgt den Richtlinien einer modernen Freskorestaurierung, die auf eine Auffrischung der alten Farben abzielt, ohne die durch die Jahrhunderte entstandenen Schäden kaschieren zu wollen, wobei sogar leere Flecken im Gesamtbild zurückbleiben können (wie etwa im Falle Giotti in Assisi)«, so der Komponist im Werkkommentar.
Eingeführt werden diese »Füllstücke« jeweils vom Glockenklang der Celesta. Da treffen im 2. Satz lyrische Reminiszenzen von Schuberts »Winterreise« auf Klänge, die auf Mendelssohn vorausweisen oder in Mahlers 76 Jahre später entstandenen »Kindertotenliedern« auftauchen könnten, und auf Kontrapunkt-Übungsskizzen, die Schubert in seinem letzten Lebensjahr angefertigt hat. Berio nutzt diesen Kanon in Gegenbewegung für eine traumverlorene Oboen-Melodie, die sich mit dem Fagott verbindet und dann alle Bläser ineinanderschlingen lässt. Später erklingt eine spukhafte Fis-Dur-Melodie.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Im 3. Satz lässt Berio (oder Schubert? oder beide?) den Solo-Cellisten mit einer tänzerischen Melodie von der Leine, die von anderen Instrumentengruppen aufgegriffen wird. Eine Art »Hungarian Touch«, es könnte ein Bauerntanz sein, den Schubert (oder Berio) auf einem ländlichem Tanzboden erlebt und notiert haben. Ein erneut kontrapunktisch grundiertes Rondo-Thema, ein fulminantes Fugato, gewaltige Schubert-Akkorde, die Berio immer wieder geradezu einfrieren lässt und so die explosive Ausbruchsfreude jäh unterbricht. Das Schubert’sche Ausgangsmaterial ist der wohl polyphonste Orchestersatz, den er je komponiert hat – und trifft auf Berios liebevolle Ergänzungen, ganz entlang der in seinen Lectures »Remembering the future« formulierten Theorie, dass der musikalische Schatz der Menschheit heute wie in einem Warenhaus greifbar sei, in dem Werke aus sämtlichen Epochen direkt nebeneinanderstehen könnten und sich gegenseitig befruchten.
Mit Berios »Rendering«, präsentiert vom Uraufführungsorchester, dem Concertgebouw Amsterdam unter Klaus Mäkelä, gelang dem Musikfest Berlin eine überwältigende Eröffnung. Aber in gleicher Weise erstrahlte Béla Bartóks »Konzert für Orchester«, das darauf folgte, auf einzigartige Weise. Besonders den 3. Satz aus Bartóks Werk mit den düsteren transsylvanischen Klagegesängen werden die Zuhörer*innen wohl nicht so schnell vergessen. Hier gelang dem Komponisten ein dramatisch-desperates Spiegelbild der deprimierenden Entstehungszeit 1943, als Bartók und seine Frau längst vor Hitler und dem bedrückenden politischen Klima in Ungarn nach New York geflohen waren, wo er schwer erkrankt aus der Ferne das Grauen des Nationalsozialismus betrachtete.
Mäkelä gönnt uns nach der Elegie keine Besinnungspause, er schließt das wilde Intermezzo mit slowakischer und ungarischer Volksmusik direkt an – alternativloses »Weitermachen«, wie auf dem Grabstein Herbert Marcuses steht. Doch dieses Bartók’sche Weitermachen ist mit Verzweiflung grundiert: Zitate aus Schostakowitschs »Leningrad«-Sinfonie und aus der Operette »Die lustige Witwe« von Lehár, einem von Hitlers Lieblingswerken, die Bartók umgehend durch groteske Hornfanfaren und wilde Orchestersounds ad absurdum führt, zeigen: »Das alles« ist noch längst nicht vorbei.
Die Zuhörer*innen waren unweigerlich schockverliebt in das Concertgebouw mit seinen herausragenden Bläsern, seinen sagenhaften Streichern und dem irisierenden Farbenrausch. Standing Ovations, naturalmente.
Der künstlerische Leiter des Musikfests Winrich Hopp legt seit jeher Wert auf besondere Programme; dabei sind die Moderne und das Zeitgenössische anders als in vielen Abonnementserien hier ein unverzichtbarer Bestandteil. Dieses Jahr werden die Jubiläen von Luciano Berio, Pierre Boulez oder Helmut Lachenmann mit jeweils spannender Werkauswahl gefeiert.
Auch das famose Orchestre de Paris unter Leitung von Esa-Pekka Salonen brachte ein Stück Berios zu Gehör: »Requies« (1983/84) ist ein beklemmender Trauergesang auf die Vokalistin Cathy Berberian, mit der der Komponist verheiratet war und die am 7. März 1983 überraschend starb, einen Tag bevor sie im Fernsehen zum 100. Todestag von Karl Marx die »Internationale« singen wollte, allerdings »im Stil von Marylin Monroe«.
»Requies« (lat. Ruhe, Rast) ist um den Grundton cis komponiert. Das Orchester beschreibt eher eine Melodie, als dass es sie spielt, sagte Berio, »aber nur wie ein Schatten ein Objekt und ein Echo einen Klang beschreiben kann«. Und so ist das Stück ein zurückhaltend flirrendes Echo, das sich zwar kurz vor dem Ende in einem Fortissimo-Rausch entlädt, dann aber wieder zu dem cis des Beginns zurückkehrt, umschmeichelt von einer zarten Flötenmelodie.
Zu einem Höhepunkt nicht nur dieses Konzerts gerät die darauffolgende deutsche Erstaufführung von Esa-Pekka Salonens »Konzert für Horn und Orchester«, erst zwei Tage zuvor beim Lucerne Festival aus der Taufe gehoben. Dieses Konzert ist Stefan Dohr, dem gefeierten Solohornisten der Berliner Philharmoniker, geradezu auf den Leib geschrieben. Von Robert Schumann wissen wir, dass »der Klang des Horns die Seele des Orchesters« ist. Viel zu selten kann die Seele jedoch aus dem Orchester hervortreten und solistisch agieren. Salonens Werk gibt dem Instrument die Chance, dies vehement zu ändern.
Ein Motiv, das zunächst vom Naturhorn, also ohne Verwendung der Ventile, zu einer Harmonik aus synthetischen Obertönen gespielt wird, zieht sich durch das ganze Stück. Wir hören Horn-Monologe, Stellen, in denen der Solist gleichzeitig spielt und singt, also gewissermaßen mit sich selbst mehrstimmig wird, wie es weiland der Posaunist Albert Mangelsdorff mit seinen »Multiphonics« vorantrieb – eine Technik, die von den Hornisten des 19. Jahrhunderts entwickelt wurde.
Salonens Komposition oszilliert gerade im Adagio zwischen ruhigen und erregten Phasen und verwendet mitunter Zitate, etwa aus Bruckners 4. Sinfonie oder den »Mystischen Akkord« aus Skrjabins »Prométhée«. Musikalisch erinnert das an die schillernde Filmmusik, die zum Beispiel Egisto Macchi in den 70er Jahren geschrieben hat (»Gangsters ’70«). Stefan Dohr kann seine unglaubliche Virtuosität bis an die Grenzen der physischen Möglichkeiten ausreizen, wobei dies immer im Dienst der spannenden Komposition steht. Toll!
Bei der Gelegenheit sei auch auf den Dirigenten und Komponisten Salonen hingewiesen. Er ist kein Pultstar im eigentlichen Sinn, hat nichts Dämonisches an sich und tanzt nicht wild auf dem Podium herum. Aber er ist ein enorm präziser Dirigent, der aus dem Orchester alles herausholt, was es anzubieten hat. Er gehört in die Kategorie der hervorragenden, aber bescheidenen Musiker, die sich ganz in den Dienst der Musik stellen. Eine Qualität, die man in Zeiten der auf vielen Ebenen aus dem Ruder laufenden Kulturindustrie nicht genug würdigen kann.
Am Abend zuvor hat das Netherlands Radio Philharmonic Orchestra unter Leitung von Karina Canellakis nach einer etwas spröden Interpretation von Messiaens »Les offrandes oubliées« »Die Sonne des Wassers«, »Le soleil des eaux«, von Pierre Boulez mit zwei Gedichten von René Char zur Aufführung gebracht. Der immens schwierige Solopart lag bei der Sopranistin Liv Redpath.
Das Stück erzählt in kaleidoskopartig zusammengesetzten kurzen Szenen vom Kampf der Fischer im südfranzösischen Vaucluse gegen die Verseuchung des Flusses Sorgue durch die Abwässer einer geplanten Gipsfabrik. Liv Redpath lässt die in Teilen unbegleiteten Zeilen faszinierend durch die Philharmonie strahlen und verhallen. »Fluss, Erde ist Schauder in dir, Sonne Beklommenheit. / Dass jeder Arme in seiner Nacht aus deiner Ernte das Brot sich machte.«
Im Wechsel zwischen Solostimme und Chor (beeindruckend der Netherlands Radio Choir) sowie dem Orchester, das im zweiten Gesang die Führung übernimmt, wird die Musik »selbst zum Bild des Flusses, an den der Chor seine Stimme richtet«, wie Martin Wilkening im vorzüglichen Programmheft schreibt.
»Fluss, dem die kerkerverrückte Welt nie das Herz brechen konnte, / Wild lass uns bleiben und freundlich den Bienen der Horizonte.« So endet das 1948 von René Char und dem 23-jährigen Pierre Boulez formulierte und 1965 in der beim Musikfest zu hörenden Fassung, die im Oktober vor 60 Jahren von den Berliner Philharmonikern uraufgeführt wurde, weiterverarbeitete eindrucksvolle Plädoyer für die Natur und gegen Umweltzerstörung. Welch ein schönes Motto für das Musikfest Berlin 2025!
Die besprochenen Konzerte können in der Mediathek der Berliner Festspiele abgerufen werden. Das Konzert des Netherlands Radio Philharmonic Orchestra wird am 14.9., 20 Uhr, im Deutschlandfunk Kultur ausgestrahlt.
Das MusikFest findet bis zum 23. September statt.
www.berlinerfestspiele.de
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.