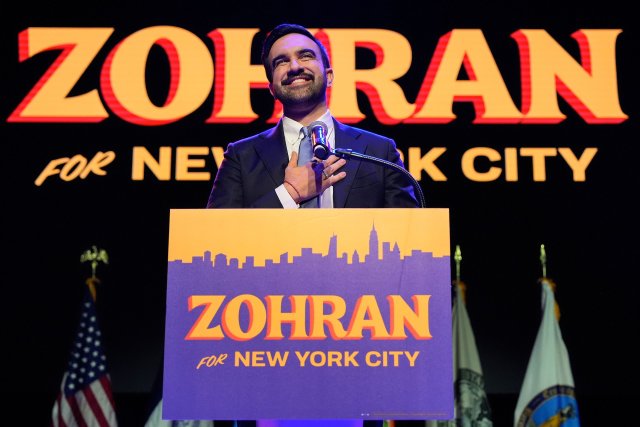- Politik
- Frankreich in der Krise
Nach Vertrauensvotum in Frankreich: Macron in der Bredouille
Frankreichs Präsident braucht nach dem verlorenen Vertrauensvotum von François Bayrou einen mehrheitsfähigen Regierungschef

Die Flucht nach vorne führte ins Aus: Premier François Bayrou hatte am Montag in der Nationalversammlung im Streit über seinen Sparhaushalt die Vertrauensfrage gestellt und versucht, die Abstimmung mit einem Bekenntnis zum Sparen in dem hoch verschuldeten Land zu verbinden. Da alle linken wie rechten Oppositionsparteien gegen ihn stimmten und das Regierungslager seit 2022 nur noch über eine Minderheit von Abgeordneten verfügt und auch von diesen einige dem Regierungschef die Unterstützung versagten, ergab das Votum nur 194 Stimmen für die Regierung und 364 gegen sie sowie 15 Enthaltungen. Von den zwei Regierungschefs seit der Parlamentsauflösung und den Neuwahlen vom Sommer 2024 hat François Bayrou immerhin 269 Tage durchgehalten, während es sein Vorgänger Michel Barnier nur auf 99 Tage gebracht hatte. Jetzt muss Präsident Emmanuel Macron zum dritten Mal in seiner regulär noch bis April 2027 andauernden zweiten Amtszeit einen möglichen Premierminister finden und mit der Regierungsbildung beauftragen.
Keine Chance auf einen linken Premier
Die linke Bewegung La France insoumise (LFI), die den Posten des Premiers beansprucht und sich dabei auf ihre relative Mehrheit bei der vergangenen Parlamentswahl beruft, hat sicher auch diesmal keine Chance. Präsident Macron will und braucht einen Kandidaten, der Kompromisse aushandeln und auf die Unterstützung nicht nur des Regierungslagers, sondern von Fall zu Fall auch der rechten oder der linken Opposition zählen kann. All das ist bei LFI nicht gegeben, zumal diese sich jetzt ganz auf ihre unrealistische Forderung nach einer Amtsenthebung von Präsident Emmanuel Macron konzentriert. Doch die Linke kann durchaus auf Posten und Einfluss in der künftigen Regierung hoffen, denn Präsident Macron hat es in den vergangenen Tagen und Wochen nicht an Zeichen fehlen lassen, dass er bereit ist, die Sozialistische Partei (PS) mitregieren zu lassen. Deren Vorsitzender Olivier Faure ist dafür offen und wäre sogar bereit, den Posten des Regierungschefs zu übernehmen.
Einen Eintritt der Sozialisten in eine Regierung würde das linke Wahlbündnis Nouveau Front Populaire (NFP) nicht überleben. Der LFI-Gründer Jean-Luc Mélenchon, der seit Wochen schärfer und populistischer denn je auftritt, nennt allein schon das Gedankenspiel Verrat. Ob es zu einer Art Großer Koalition kommt, was für Frankreich eine absolute Neuheit wäre, und ob es sozialistische Minister geben wird, bleibt abzuwarten. Eine Minimalvariante wäre eine Unterstützung der Regierung von Fall zu Fall durch die 66 PS-Abgeordneten in der Nationalversammlung, so wie es in den zurückliegenden Monaten die Abgeordneten der rechten Oppositionspartei der Republikaner gehalten haben und wahrscheinlich auch weiter halten werden.
Kein Zweifel am »Heißen Herbst«
Doch den »Heißen Herbst«, auf den sich viele Franzosen seit Monaten eingestellt haben, lassen sie sich durch die jüngsten innenpolitischen Verschiebungen nicht nehmen. Mit ihm wollen sie gegen die vielen Sparmaßnahmen im Staatshaushalt und vor allem gegen die Kürzungen bei den Sozialausgaben protestieren. Besonders gespannt ist man auf den Aktionstag am 10. September unter dem Motto »Alles blockieren« (Bloquons tout). Dabei soll über einen Generalstreik in der Wirtschaft hinaus auch der öffentliche Sektor, das Verkehrs- und Gesundheitswesen sowie Handel und Gewerbe lahmgelegt werden, um Präsident Macron und seiner Regierung einen Denkzettel zu verpassen und eine Kurswende zu erzwingen. Ob das funktioniert, ist allerdings fraglich, zumal die Organisatoren bis zuletzt mit kaum mehr als 100 000 Teilnehmern fest rechnen konnten. Dagegen brachten 2023 die machtvollsten Aktionstage gegen die Rentenreform nach Zählungen der Polizei 750 000 Menschen und nach Angaben der Organisatoren 1,2 Millionen auf die Straße.
Die Blockadebewegung ist interessant, zumal sie etwas ganz Neues ist. Sie entstand spontan ohne erkennbaren Einfluss von Parteien oder Organisationen und entwickelte sich im Internet und dann durch improvisierte Treffen in verschiedenen Landesteilen. Die Bewegung der Gelbwesten von 2018/2019 wurde vor allem von Franzosen der unteren Mittelschicht getragen, die um die Kaufkraft ihrer Einkünfte bangten. Sie war nicht unempfänglich für ausländerfeindliche Parolen der Rechtsextremen. Dagegen kommen die Blockade-Aktivisten offenbar eher aus Kreisen linksmilitanter Akademiker und Studenten, die das politische System von Grund auf »umkrempeln« wollen. Ihr Erfolg wird allerdings dadurch infrage gestellt, dass die Gewerkschaften sich von Anfang an von ihnen distanziert haben und alle Kräfte auf die Vorbereitung der Streiks und Demonstrationen an ihrem eigenen Aktionstag am 18. September konzentrieren.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.