- Sport
- Leichtathletik
Tokios Nationalstadion: Endlich ist die Welt zu Gast
Am Samstag beginnt die Leichtathletik-WM – anders als bei »Tokyo 2020« wird das Nationalstadion voll sein

Als die Hochspringerin die Stange gerissen hatte, war deutlich zu hören, wie sie auf die blaue Matte fiel, zeitgleich mit ihr die fallende Stange. Ihr Fluchen hallte noch sekundenlang durchs Stadion mit seinen leeren Rängen. Abgesehen von den Fernsehkameras mutete hier alles nach einem Amateursportevent an, für das sich außer den Aktiven und ein paar Offiziellen niemand wirklich interessierte. Dabei waren hier, im gerade frisch eingeweihten Tokioter Nationalstadion, nur die Besten der Welt anwesend.
Die Geisteratmosphäre jener Tage hat sich ins Gedächtnis eingebrannt. Vier Jahre ist es her, dass Tokio die Olympischen Sommerspiele ausrichtete. Anfang 2020 machte das damals »neuartige Coronavirus« weltweit die Runde, sodass das für 2020 geplante Weltsportfest um ein Jahr verschoben wurde. Weil die Pandemie auch 2021 danach nicht unter Kontrolle war, fand »Tokyo 2020« letztlich vor leeren Rängen statt.
Jetzt aber hat die japanische Hauptstadt eine neue Chance, die Sportwelt von sich als feierlicher Gastgeberin zu überzeugen. Wenn ab Sonnabend für neun Tage die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Tokio läuft, werden immerhin 2000 Athletinnen und Athleten aus gut 200 Ländern und Regionen in 49 Wettbewerben um Medaillen kämpfen. So markiert dieses große Finale der Leichtathletik-Saison für die Austragungsstadt auch eine Art nachgeholte Olympiaparty. Vor allem für das Stadion.
Schon am Sonntagabend Ortszeit laufen hier die Frauen um Gold über 100 Meter, Olympiasiegerin Julien Alfred wird sich mit Weltmeisterin Sha’Carri Richardson messen. Das Finale der Männer mit Olympiasieger Noah Lyles folgt direkt danach. Ein weiteres Top-Event wird am Montag der Auftritt von Stabhochspringer Armand Duplantis, der bei den Sommerspielen von Paris 2024 zu den größten Stars zählte. All dies dürfte in Tokio diesmal für lauten Jubel sorgen, bei endlich vollem Haus.
Das gut 60 000 Menschen fassende Oval, das vom japanischen Stararchitekten Kengo Kuma mit vielen Holzelementen in Treppenhaus und Dach konzipiert wurde und an der Fassade mit Pflanzentöpfen verziert ist, fügt sich harmonisch in den Meiji-Park ein, der eigentlich einem Schreingelände dient. Bevor dieses Stadion für die 2020 geplanten Tokioter Spiele für umgerechnet mehr als eine Milliarde Euro gebaut wurde, hatte an gleicher Stelle das Olympiastadion der Sommerspiele 1964 gestanden.
Als Verschwendung ist der teure Neubau kritisiert worden.
Der teure Neubau ist als Verschwendung kritisiert worden, weil ihn viele schlicht als Verschwendung öffentlicher Gelder ansahen. Zum Vergleich: Als Unterstützer des FC St. Pauli dieses Jahr eine Genossenschaft gründeten, um den Klub mit einem Erwerb der Mehrheit des knapp 30 000 Zuschauer fassenden Millerntor-Stadions finanziell zu unterstützen, reichten für das Vorhaben knapp 30 Millionen Euro aus.
Erschwerend hinzu kommt, dass das Nationalstadion nach den Spielen 2021 zunächst kaum genutzt worden ist. Der öffentliche Sektor sah sich gezwungen, den Unterhalt des Stadions mit jährlich bis zu zwei Milliarden Yen (elf Millionen Euro) zu bezuschussen. Auch nachdem im Mai dieses Jahres ein Konsortium, das unter anderem den Ex-Telekommunikationsmonopolisten NTT und die Fußballliga J-League beinhaltet, das Management übernommen hat, wird das Stadion subventioniert.
Der Appetit der japanischen Gesellschaft auf die Austragung großer Sportevents hat seit »Tokyo 2020« deutlich abgenommen. Die Olympiaorganisatoren hatten anfangs behauptet, das Event würde eine riesige internationale Party werden, die die Steuerzahlerinnen nichts kosten würde. Am Ende stand ein Ereignis, das im Corona-Ausnahmezustand nur noch für die zahlenden Sponsoren stattfand, das keine Besucher ins Land ließ und auch noch mehrere Milliarden an Steuergeld kostete.
Bevor die Spiele begannen, waren 2021 laut Umfragen mehr als 80 Prozent der Menschen gegen die Austragung des Events. Und die schönen TV-Bilder, die Tokio dank des IOC-Monopols auf Bildproduktion dennoch liefern konnte, versöhnten die Menschen auch nur kurzfristig mit dem Ereignis. Kurz nach den Spielen wurde offenbar, wie Offizielle und Sponsoren bestochen hatten, um die Spiele nach Tokio zu holen. Inmitten öffentlicher Kritik zog sich dann Sapporo vom Plan, 2030 die Winterspiele zu veranstalten, zurück.
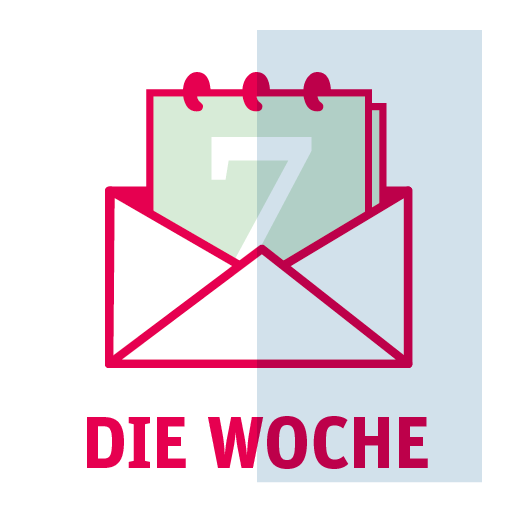
Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Kann nun also die Leichtathletik-WM in Tokio für ein bisschen Versöhnung sorgen? Takashi Takeichi von der Metropolregierung Tokio scheint sich der Herausforderung bewusst zu sein. Gegenüber der Nachrichtenagentur AFP sagte er: »Wenn wir eine tadellose WM abliefern, können wir damit beweisen, dass Tokio eine Topdestination für den Weltsport ist.« Wobei Takeichi zugab: »Wenn es uns nicht gelingt, die Öffentlichkeit zu bewegen, wird es umso schwieriger, das Vertrauen wiederzugewinnen.«
Dafür wird wiederum einiges getan. Während der WM wird viel von dem nachgeholt, was rund um »Tokyo 2020« ins Wasser fiel, zum Beispiel das »Host City«-Programm, nach dem Städte in der Region nationale Athletendelegationen bestimmter Länder beherbergen und unterstützen. So heißt die Präfektur Gifu Kanada willkommen. Für einen Empfang dieses Wochenende hat eine Gruppe von Schülerinnen die kanadische Nationalhymne einstudiert.
Es ist einer von mehreren Versuchen, den japanischen Nachwuchs mit der weiten Welt in Verbindung zu bringen, die schon vor vier Jahren, bei den Geisterspielen von Tokio, für Begeisterung sorgen sollten.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.







