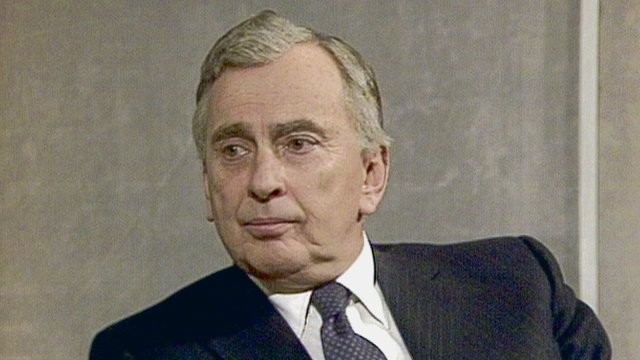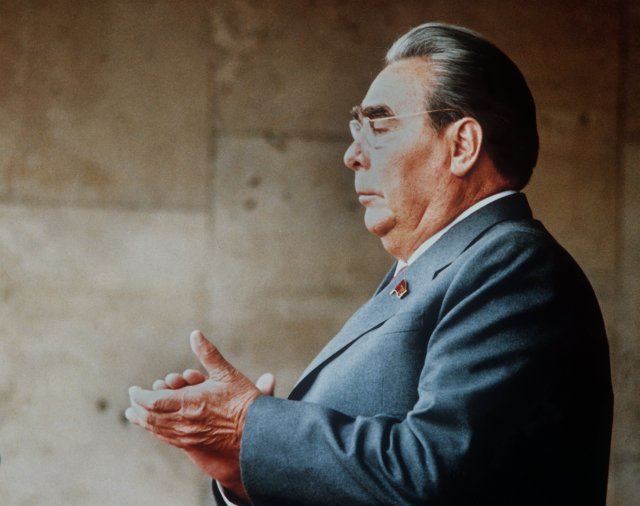- Kultur
- DDR-Geschichte
Es klirren keine Fahnen
Ilko-Sascha Kowalczuk und Bodo Ramelow: »Die neue Mauer. Gespräch über den Osten«

Freiheit ist der Gang in eine Fremde. Jeder Morgen: ein Wagnis. Wer sich zur Freiheit bekennt, bejaht die Unwägbarkeit des Lebens. Kein einfach Ding. Frei ist vor allem, wer sich unerschrocken der Entzündbarkeit seines Gewissensnervs aussetzt. In einer festgezurrten Welt aus Gewinnern und Verlierern. In der jeder tagtäglich mehr hinnimmt und aushält, als für ihn gut ist. Darüber reden Ilko-Sascha Kowalczuk und Bodo Ramelow im Buch »Die neue Mauer. Ein Gespräch über den Osten«.
Es bedenken einander: der Ost-Autor, der aus staatsnahem Elternhaus und frühen Sozialismusträumen in ein grundsätzliches »Nein!« zum SED-Regime floh, und der westdeutsche Lebensmittelkaufmann »mit dem Schwerpunkt Wild und Geflügel – das heißt, alles, was im Wald rumläuft, mache ich küchenfertig«. Der Historiker und der Politiker. Der eine, der sich durch die Geschichte schreibt, der andere, der als erster linker Ministerpräsident in Thüringen Geschichte schrieb. Der strubblige bekennende Antikommunist und der gescheitelte gottesgläubige Linke. Der »schwafelnde Intellektuelle« (so Kowalczuk ironisch über sich selbst) und der gewerkschaftsgestählte Pragmatiker.
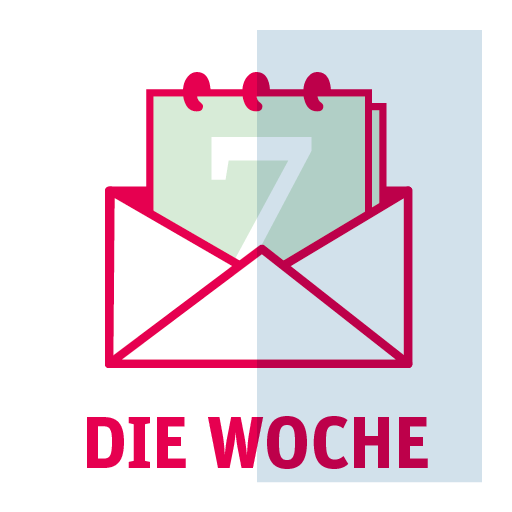
Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Ein Dichterwort passt zwar kaum in ein Gespräch darüber, ob die DDR ein Unrechtsstaat war oder nicht, ob die Treuhand »kolonial« (Ramelow) agierte oder auch nutzbringend; aber Hölderlins berühmte Welt-Wahrnehmung (»Die Mauern stehn/Sprachlos und kalt …«) darf hier trotzdem erwähnt werden – weil nämlich eines, was der große deutsche Poet einst spürte, in diesem Disput wohltuend ausbleibt: Es klirren im Wind der Worte und Widerworte keine Fahnen. Obwohl Ramelow – wie tröstlich, wenn so etwas von links kommt – nichts gegen Schwarz-Rot-Gold hat: »… bei der Fußballweltmeisterschaft in Berlin 2006 habe ich das erlebt. Alle sind mit der deutschen Fahne rumgelaufen. Nur die Linken haben gesagt, das muss man unterbinden. Ihr seid alle irre, habe ich gesagt.« Kowalczuk, im Übrigen einer der wenigen Berliner, die Union- und Hertha-Fans gleichermaßen sind, setzt dagegen: »Nein, Nationalstolz ist immer vom Ausschlussgedanken geprägt.«
Der Themenpark ist ein dichtes Gestrüpp – Neoliberalismus, AfD (Kowalczuk: »Wer faschistische Parteien wählt, ist selber ein Faschist«), Stasi-Akten (Ramelow: »dieser letzte Dreck«), Antiamerikanismus, Idealisierung Gorbatschows, die Jugoslawien-Kriege … Die Fakten überzeugen im gleichen Maße, wie sie überborden. Alles Gewichtige der neun Kapitel bildet ein durchaus steiniges Gelände. Angesichts dessen gilt die alte Bergwanderregel: Spring ins Geröll oder meide es!
Kowalczuk streitet gegen ein ominöses »Wir«, wenn speziell Politiker der Linken über den Osten und dessen »Opferrolle« beim Einheitsprozess reden. »… es gab Millionen, die es genau so wollten, wie es dann abgelaufen ist. Sie wurden gewissermaßen zu Steigbügelhaltern der westlichen Arroganz.« Ramelow: »Da sind wir uns ja wieder einig.« Kowalczuk: »Eigentlich sind wir uns bislang viel zu häufig einig …«
Mich interessierte nicht alles. Die Atmosphäre des Gesprächs schon. Ob nun Jugendweihe oder jüngere deutsche Filme oder Zwangsadoptionen oder Krieg (Kowalczuk und Ramelow im Vorwort: »Putins Krieg gegen die Ukraine ist kein Stellvertreterkrieg, sondern ein Krieg, bei dem es um Freiheit versus Unfreiheit, Demokratie versus Diktatur geht«) – was mich beim Lesen antrieb, war das, was als Grundfrage nach allen Antworten bleibt: Wie kann der Mensch wesentlich bleiben, ohne Opfer seiner instrumentell so verführbaren Vernunft zu werden?
Beide sehen, wie nervös unsere Gesellschaft wurde und gleichzeitig in innerer Ermüdung steckt. Beim Blick auf die globalisierte, autoritär werdende Welt ist oft von »Verlustängsten« die Rede. Aber: Die Gesprächspartner wehren sich gegen jedwede Gleichgültigkeit. Ramelow plädiert für »mehr direkte Demokratie, mehr direkte Steuerungsfähigkeit.« Damit ist auch der Sozialwert von Politik angesprochen: »Ich beurteile den humanitären Charakter einer Gesellschaft danach, wie sie mit den Schwächsten, den Außenseitern umgeht« (Kowalczuk).
Du stehst, wenn du die DDR mit durchpulstem Ja-Wort gelebt hast, nicht sehr gut da im leidenschaftlich ruppigen Ab-Urteil von Kowalczuk. Du sagst Überzeugung, er sagt Anpassung und Selbsttäuschung. Du sagst Geborgenheit, er sagt Rundum-Betonierung. Aber: Was wehtun mag, ist Gewinn. Der darin besteht, diese unnachsichtigen, an keiner Stelle umwatteten Gedanken auszuhalten. Es ist gut möglich, sich als aktiver Teilnehmer des Experiments DDR durch Kowalczuks Äußerungen verletzt zu fühlen. Am Ende freilich auch: sich erkannt zu wissen.
Kowalczuks Antikommunismus ist nachvollziehbar, da er nicht den Hass auf eine Ur-Idee des Humanen meint, sondern die Beschädigung durch eine machtpolitische Walze – deren Ausdruck für ihn die DDR war. Und Ramelows Linkssein wiederum ist frei von jeglicher avantgardistischer Anmaßung, Utopie und Unschuld, wieder vereinen zu wollen. So verabscheut er jene linke Militanz, allein schon die bürgerliche Idee der Mitte als verachtenswert zu betrachten.
Einmal mehr: Der hundertprozentig Progressive ist doch, wie sein konservativer Feindbruder, nur ein Phantom. Die mentale politische Landkarte des Menschen ist nicht einfarbig, sei es rot oder sonst wie, sondern scheckig wie ein Flickenteppich – jeder hat exzentrische Kleckse, Leerstellen der Ignoranz, Grauwerte der Gleichgültigkeit. Vor allem: Grünpunkte der Größe, beim eigenen Standpunkt stets auch einen Widerpart mitdenken zu können.
Immer wieder also spürbar: Differenzierungen, Abweichungen vom groben Lagergeist. Kowalczuk: »Der Wahlerfolg für die Linkspartei ist dank ihres sozialpolitischen Engagements sehr verdient, aber ich habe nach wie vor große Bauchschmerzen, wenn es um die Außenpolitik geht, die die Linke vertritt.« Ramelow: »Die Verlässlichkeit der Bundeswehr als ein Teil unserer Gesellschaft ist etwas, das ich als Ministerpräsident hoch zu schätzen gelernt habe.«
Kowalczuk sieht im Osten viel Hass, erst mählich entwickle sich die entschiedene Zivilgesellschaft. Ramelow: »Struktureller Rassismus hat die DDR geprägt. Von den politisch Verantwortlichen, auch in meiner Partei, war aber nie gewollt, dass darüber deutlich geredet wird.« Dann erzählt Ramelow von Ausgrenzungen, von Arbeitskämpfen in Thüringen. Ausstand! Courage! Wie leicht das in Aufrufe und Leitartikel fließt. »Aber als Streikleiter darf man nie den Respekt vor dem einzelnen Streikenden verlieren, der die Angst überwinden muss.«
Kowalczuk spricht tiefe soziale, politische Gräben an. Ramelow, der Niedersachse, findet ein treffliches Bild für seine Ankunft in Thüringen: »Ich habe mich damals mit dem Spaten unter den Gräben durchgegraben.« So geht auch das Gespräch. Es lässt ein wenig an Reiner Kunze erinnern: »rudern zwei/ ein boot,/ der eine/ kundig der sterne,/ der andere kundig der stürme,/ wird der eine/ führn durch die sterne,/ wird der andre/ führn durch die stürme,/ und am ende ganz am ende/ wird das meer in der erinnerung/ blau sein«.
Es müssten also im politischen Miteinander stets zwei Wahrheiten zusammenfinden: Dass die Ideale nicht zu Ende sind, davon erzählen die einen, aber dass auch die tägliche Entzauberung der Ideale weitergeht, davon erzählen die anderen. Der Blick derer, die neugierig aufschauen, möge sich mit dem Blick derer kreuzen, die leider schon zu viel gesehen haben. Wahre Demokratie beginnt wahrscheinlich dort, wo ein enorm Aufgebrachter radikale Fragen aufwirft und einem äußerst Aufgeräumten die Antworten überlässt.
Immer wieder spürbar: Differenzierungen, Abweichungen vom groben Lagergeist.
-
Die Zukunft Deutschlands, Europas? Das Gespräch sagt: Traumbereitschaft mit Skepsis. Alles wünschenswert Bessere dieser Welt wird von der Frage belastet sein, wie es fern kollektiver Zwangsversuche gelingt, individuelle Weisheit und Einsicht auf soziale, politische Institutionen zu übertragen. An solchen Fertigkeiten werden sich wohl auch linke Parteien, belehrt von programmatischem Überschaum, auf lange Sicht abarbeiten müssen.
Ramelow: »Nichts ist so schön wie ein lernender Prozess, bei dem ein Irrtum zur Stärke, ein Ausprobieren zur Normalität und Solidarität zum Leitgedanken wird.« Kowalczuk, der den Herbst 1989 in prononcierter Deutungslust eine »Freiheitsrevolution« nennt: »Was mich an historischen Prozessen fasziniert, ist die Tatsache, dass es nie so linear verläuft, wie es dargestellt wird. Geschichte verläuft nie so, wie wir sie uns wünschen.« Schönes Lob des einzig Gewissen: des Ungeahnten. In offenem Werksgelände. Beide Autoren im Vorwort: »Deutschland ist eines: vieles!« Man kann sich fürchten, man darf hoffen.
Ilko-Sascha Kowalczuk/Bodo Ramelow: Die neue Mauer. Ein Gespräch über den Osten. C. H. Beck, 239 S., geb., 24 €.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser:innen und Autor:innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.