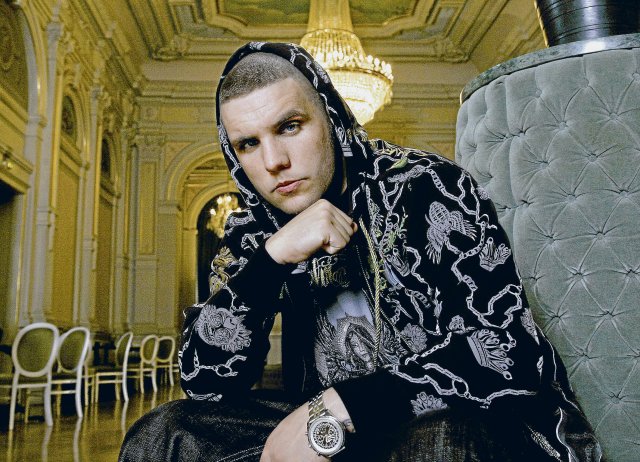- Kultur
- Einheit
Deutscher Nationalstaat: Was zusammengehört
Warum müssen die deutschen Regionen ein einheitlicher Nationalstaat sein?

Meine deutsche Einheit vollzog sich im Frühjahr 1990. Im November waren die Ossis zu uns gekommen, wir hatten ihnen auf die Trabbis geklopft, die Ossis hatten komische Klamotten angehabt und irgendwie lieb dreingeschaut, bei uns, in Lübeck-Schlutup, an der Grenze. Im Hintergrund waren Leute mit Deutschlandfahnen umhergelaufen.
Damals waren mir die Ossis noch fremd. Ich hatte keine Verwandten da drüben. Der Zaun an unserer Stadtgrenze, an dem man erschossen werden konnte – war für uns Normalität. Da hörte die Welt halt auf. Im Fernsehen konnten wir DDR-Fernsehen gucken, Heinz Florian Oertel, Kollege Schnitzler und das Fernsehballett, alles leider nur in Schwarz-Weiß. Ob die DDR nun der BRD beitreten würde? Ich war jung, mir war es verhältnismäßig egal. Berührend war, dass die Ossis jetzt überall rumfahren durften. Einmal traf ich ein älteres Pärchen, das sich bei mir heiter beschwerte: Jetzt hätten sie endlich mal Bananen zu fassen gekriegt, da stellte sich raus, das Enkelkind mochte die gar nicht!
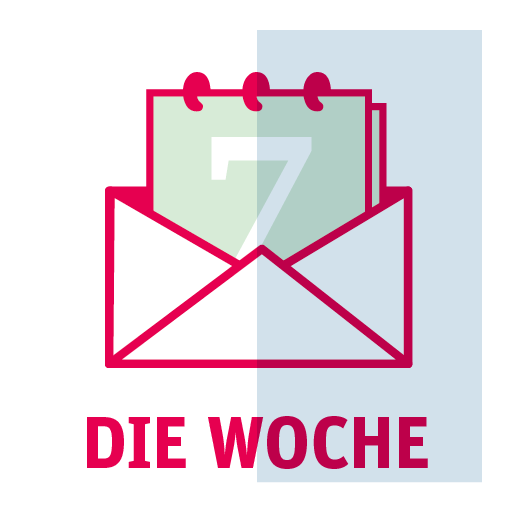
Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Die Wiedervereinigung, in weiten Teilen Deutschlands las man nur darüber oder hörte in der Tagesschau davon. In Lübeck erlebten wir sie täglich: Die Leute legten Bananenstauden auf die Trabbis, oder sie klemmten Zehnmarkscheine unter die Scheibenwischer. So drei, vier Wochen lang waren alle ganz happy. Dann senkte sich die deutsch-revolutionäre Partystimmung. Und das Gegrummel ging los. Die parken uns die Bürgersteige voll! Das stinkt! Die kriegen Geld geschenkt!
Aber uns Lübeckern hatte auch niemand erklärt, dass bei uns tatsächlich eine Einheit zusammenwuchs, oder wachsen sollte, die über Jahrhunderte bestanden hatte: Die Stadt war seit 1143 immer mit Mecklenburg eng verbunden gewesen, viel mehr als mit Holstein, das meistens irgendwelchen bescheuerten Adligen gehört hatte, die mit dem dänischen König kuschelten ... Bald wurden die Wessis wieder normal. Materialistisch. Neidisch. Freudlos. Nie verstand ich, worauf sie sich eigentlich so viel einbildeten: Niemand von uns konnte ja etwas dafür, dass wir auf der reichen, amerikanischen Seite des Zauns gelandet waren, während die Ossis sich mit Pappautos und Schießbefehl befassen mussten.
Meine persönliche deutsche Einheit vollzog sich dann im Frühjahr. Im April 1990 gewann ich bei den »Lübecker Nachrichten« Tickets für das FDGB-Pokal-Halbfinalspiel Dynamo Schwerin gegen Lok Leipzig. Und während wir also, unweit Lübecks, ins Schweriner Stadion schlenderten, dröhnten die Sprechchöre der Heimfans: Sachsen raus! Sachsen raus!
Für mich jungen Menschen war das eine vollkommen überraschende Erkenntnis: Die Leute da hinter dem Zaun waren also gar nicht allesamt Sachsen? Hinter Städtenamen wie Greifswald, Rostock, Wismar verbargen sich – Hansestädte? Die Leute hatten fast denselben Schnack drauf wie wir, bisschen härter, bisschen breiter, aber schon gutes, braves Norddeutsch?
Endlich wächst zusammen, was zusammengehört. Das hatte unser Willy gesagt, Lübecker Jung wie wir. Was aber gehört zusammen? Wenn man mal ehrlich ist? Für mich als Nordlicht: Lübeck und Mecklenburg, Stormarn und Friesland und Bremen und Hamburg und Oldenburg und meinethalben fucking Holstein, all das Zeug, wo man mit dem Fahrrad zum Strand fahren kann. Von mir aus können auch südliche Städte wie Berlin oder Hannover dazugehören. Aber dann muss auch mal Schluss sein mit der Nation.
Wer sagt denn, dass Deutschland ein möglichst großer, möglichst starker Einheitsstaat sein muss? Seit Bismarck wissen wir, was für eine doofe Idee das ist. Ist nicht die Region dasjenige, wo die Menschen sich wirklich zugehörig fühlen? Ist Deutschland mehr als ein Wirtschaftsraum, der einen Haufen auseinander strebender Regional-Identitäten verbindet? Deutschland? Ein unmöglicher Trumm, der sich seiner Unmöglichkeit auch immer schon bewusst gewesen ist.
Andere Nationen sind schlüssig definiert. Die Briten haben ihre Inseln. Da weiß man, wo die aufhören. Die Franzosen: Hier die Alpen, da der Rhein, da der Kanal, da das Mittelmeer, da die Pyrenäen. Alles geritzt. Punkt. Deutschland war immer viel zu groß und hat nie klare Umrisse gehabt, es lag schwammig mitten im Kontinent herum wie eine gescheiterte Qualle, franste nach Dänemark oder Böhmen oder Frankreich oder Italien aus – und gehört eigentlich Österreich(-Ungarn) dazu? Warum nicht die deutschsprachige Schweiz?
All diese Fragen sind nie nachvollziehbar gelöst worden, und lange Zeit mussten sie das auch gar nicht. Denn von 962 bis 1806 funktionierte das so »Heilige Römische Reich deutscher Nation« ganz gut, so als wabbliges Geschwabbel in der Mitte Europas. Es war ein Konglomerat aus Hunderten kleineren und größeren Landschaften und Reichsstädten, in dem sich laufend abgestimmt wurde. Der Kaiser war kein Diktator, er musste sich wählen lassen, und mangels zentralisierter Power kam auch niemand auf die Idee, allvernichtende kontinentale Eroberungskriege Richtung Frankreich und Russland vom Zaun zu brechen. Nur der Dreißigjährige Krieg stieß uns zu, eine echte deutsche Selbstzerfleischung.
Mit der lässt sich aber im Nachhinein besser leben als mit allem, was dann die Preußen im 19. Jahrhundert veranstalteten. Ein deutsches Nachbarland nach dem anderen überfielen sie, löschten dabei etwa das fortschrittliche Königreich Hannover komplett aus, überfielen Dänemark, hauten den Ösis auf die Omme. Wuchsen und wuchsen, ein Militärstaat, von dem kein Geist und keine Musik zu erwarten war. Mit all den Ländern kaperten die Preußen die romantische Idee vom deutschen Nationalstaat, und in ihrer Großmachtzeit entstand auch die abwertende Deutung: Das regionalisierte Deutschland sei ja nur ein »Flickenteppich« gewesen.
Daher ist deutscher Patriotismus so eine unschöne Angelegenheit: Deutschland, Vaterland? Das muss man schon sehr wollen. Das muss man sich zurechttrinken. Die gemeinsame Geschichte beschränkt sich, verkürzt gesagt, auf die Menschheitskatastrophen Erster und Zweiter Weltkrieg. Viel zu weit liegen die alpinen katholischen Regionen, die Mittelgebirge, das feierselige Rheinland und das norddeutsche Flachland auseinander. Deutsche Kultur? Das sind ein paar von Akademikern verordnete staatstragende Dichter, die keiner freiwillig liest. Ein paar Volkslieder, die schon lange niemand mehr singt. Aber: Als ich meinen Ausstand als Zivi im Altenheim feierte, auch 1990, da wusste ich, was die Omis mir singen sollten: das Lied von den Ostseewellen. Ein Lied, das vom Meer handelt. Alle kannten es, alle liebten es. Wie denn auch nicht!
Unser Blick als Nordlichter ist immer der aufs Meer hinaus gewesen, übers Wasser nach Dänemark und Schweden, viel eher haben wir uns unseren niedergermanischen Brüdern und Schwestern in England und den Niederlanden verbunden gefühlt als irgendwelchen mitteleuropäischen Gebirgsbewohnern. Deutschland, Einheitsland – braucht das wer? Ich persönlich würde es nicht vermissen.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.