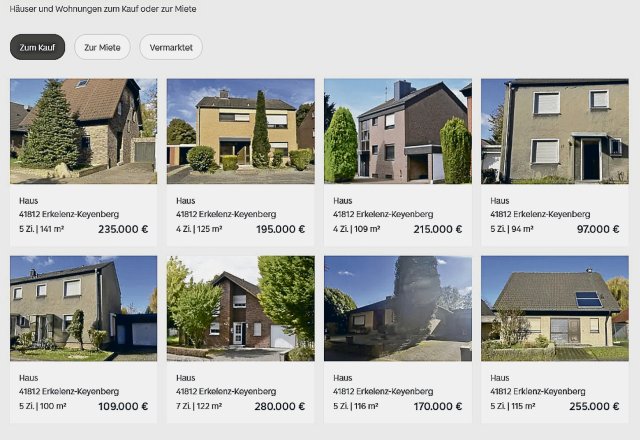- Politik
- Abbau des Sozialstaates
Vom »Herbst der Reformen« zum Winter der sozialen Kälte
Was die Abschaffung des Bürgergeldes für den Sozialstaat bedeutet

Nach einer beispiellosen Hetzkampagne gegen den Sozialstaat, das Bürgergeld und die »Totalverweigerer« hat sich der Koalitionsausschuss von CDU, CSU und SPD am 8./9. Oktober 2025 auf die die Einführung der »neuen Grundsicherung« für Arbeitsuchende verständigt. Dieser in einer Nachtsitzung geschlossene »Kompromiss« war eine Kapitulation der SPD-Führung. Sie ließ ihr eigenes arbeitsmarkt- und sozialpolitisches Prestigeprojekt, mit dem sie Hartz IV in der Ampel-Koalition hatte »überwinden« wollen, wie eine heiße Kartoffel fallen. Damit gab sie dem öffentlichen Druck von Neoliberalen, Konservativen und Rechtsextremisten einschließlich ihrer Leitmedien nach.
Umso lauter war denn auch das Triumphgeschrei führender Unionspolitiker, die aus ihrer Freude über das Ende des Bürgergeldes, in dem sie eine Variante oder Vorstufe des bedingungslosen Grundeinkommens zu erkennen glaubten, keinen Hehl machten. Voll des Lobes war mit »Bild« auch das größte Boulevardblatt der Bundesrepublik. Am 10. Oktober 2025 hatte es die Einigung auf die populistische Kurzformel »Merz streicht Faulpelzen Bürgergeld« gebracht.
CDU und CSU betrachten den Bismarckschen Sozialstaat als Klotz am Bein des Wirtschaftsstandorts Deutschland und als Sanierungsfall. Sie möchten ihn als finanziellen Steinbruch benutzen, in dem sich für den Bundeshaushalt angeblich Milliardensummen »einsparen« lassen. Selbst Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich am Sozialstaatsbashing beteiligt, als er am 16. September 2025 auf dem 83. Deutschen Fürsorgetag in Erfurt behauptete, dass »nicht nur beim Bürgergeld die Kosten aus dem Ruder laufen«, was schlicht falsch ist.
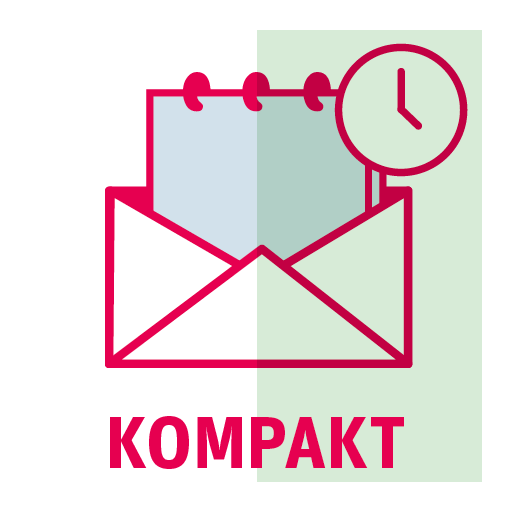
Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.
Wenn man das deutsche Bruttoinlandsprodukt, die wegen der Preisinflation ebenfalls gestiegenen Steuereinnahmen und/oder den inzwischen erheblich höheren Staatshaushalt berücksichtigt, reichen die Kosten für das Bürgergeld im Verhältnis dazu nicht an die Ausgaben für Hartz IV vor zehn oder 15 Jahren heran. Vielmehr ist der Anteil der Ausgaben für die »alte« Grundsicherung für Arbeitsuchende (bis 2022: Hartz IV; ab 2023: Bürgergeld) am Bundeshaushalt zwischen 2014 und 2024 von 14 auf zehn Prozent zurückgegangen.
Während die Wohlhabenden, Reichen und Hyperreichen schon im Frühjahr der Steuergeschenke durch »Turbo-Abschreibungen« und eine allmähliche Senkung der Körperschaftsteuer für Kapitalgesellschaften (AGs und GmbHs) von 15 auf zehn Prozent großzügig bedacht wurden, zwingt man die Menschen im Transferleistungsbezug, den Gürtel enger zu schnallen. Denn die Koalition von Union und SPD hat auch beschlossen, den Regelsatz des Bürgergeldes von derzeit 563 Euro im Monat für Alleinstehende 2026 und damit das zweite Mal in Folge nicht anzuheben.
Dabei erhöhen sich die Lebenshaltungskosten laufend. Betroffen davon sind etwa 500 000 alleinerziehende Mütter im Bürgergeldbezug, die am 20. des Monats oft nicht wissen, ob sie für ihre Kinder noch etwas Warmes auf den Tisch bekommen.
Arbeitsmarkt- und sozialpolitische Rolle rückwärts
Da der vermeintlich massenhafte Leistungsmissbrauch und die angeblich fehlenden Arbeitsanreize im Mittelpunkt der Angriffe auf das Bürgergeld der Ampel-Koalition gestanden hatten, richtete sich das Hauptaugenmerk der (Medien-)Öffentlichkeit nunmehr auf die Verschärfung der Sanktionen.
Pflichtverletzungen wie die Ablehnung eines Jobangebots, einer beruflichen Weiterbildung oder eines Bewerbungstrainings sollen sofort mit Kürzungen von 30 Prozent der Geldleistung beantwortet werden. Wird eine Arbeitsaufnahme verweigert, entfällt diese ganz. Wenn ein Transferleistungsbezieher zwei Termine beim Jobcenter verpasst, enthält man ihm 30 Prozent der Geldleistung vor. Nach dem dritten Meldeversäumnis erfolgt ein vollständiger Leistungsentzug, nach dem vierten werden außerdem die Miete und die Heizkosten nicht mehr vom Jobcenter übernommen.
Belegschaften, Betriebsräte und Gewerkschaften könnten unter dem Damoklesschwert von Hartz V, wie man die neue Grundsicherung nennen sollte, gezwungen sein, schlechtere Arbeitsbedingungen und niedrigere Löhne zu akzeptieren.
Das birgt ein hohes Verelendungsrisiko für Betroffene, die ihre Wohnung verlieren und obdachlos werden können. Die relative Einkommensarmut der Menschen im Transferleistungsbezug schlägt durch die geplanten Sanktionsverschärfungen möglicherweise in absolute, extreme und existenzielle Armut (Wohnungs- und Obdachlosigkeit) um, was zu einer Bundesregierung passt, deren Steuerpolitik maßgeblich zur Konzentration des Reichtums beiträgt und die allen Forderungen nach Umverteilung eine Absage erteilt.
Bundessozialministerin Bärbel Bas will zwar durch eine Härtefallregelung im Gesetz verhindern, dass Menschen, die kognitiv, gesundheitlich oder psychisch beeinträchtigt sind, sanktioniert werden. Leistungsberechtigte, die keinen Telefonanschluss haben und aus Angst vor dem Jobcenter dessen Briefe nicht mehr öffnen, dürften die neue Härte im Umgang mit den Armen jedoch zu spüren bekommen, auch wenn sie kaum dem Bild des »Totalverweigerers« entsprechen.
Drohkulisse gegenüber Arbeitenden und Gewerkschaften
Der alten, im Volksmund »Hartz IV« genannten Grundsicherung für Arbeitsuchende, sieht die neue Grundsicherung zum Verwechseln ähnlich. Dadurch erhöht die Koalition nicht bloß den Druck auf Langzeiterwerbslose, jeden Job anzunehmen, sondern baut auch eine weitere Drohkulisse gegenüber Belegschaften, Betriebsräten und Gewerkschaften auf, die unter dem Damoklesschwert von Hartz V, wie man die neue Grundsicherung nennen sollte, gezwungen sein könnten, schlechtere Arbeitsbedingungen und niedrigere Löhne zu akzeptieren.
Schon Hartz IV wirkte als Disziplinierungsinstrument für die Beschäftigten, mit dem man den deutschen Niedriglohnsektor zum größten dieser Art in Europa gemacht hatte. Zwar wurde der Niedriglohnsektor durch die Einführung und mehrfache Erhöhung des Mindestlohns wieder verkleinert. Nun droht aber wieder eine Expansion. Nicht zufällig erreichte der Dax nach Bekanntwerden der Beschlüsse des Koalitionsausschusses, einem schwarzen Tag für den Sozialstaat, einen historischen Höchststand.
In seinem Hartz-IV-Sanktionsurteil vom 5. November 2019 (Az. - 1 BvL 7/16) hatte der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts, gestützt auf Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes zur Würde des Menschen und das Sozialstaatsgebot von Artikel 20 Absatz 1 ausdrücklich festgestellt, dass ein vollständiger Leistungsentzug nur zu rechtfertigen sei, wenn eine existenzsichernde und zumutbare Erwerbstätigkeit ohne wichtigen Grund willentlich verweigert wird, obwohl im Verfahren die Möglichkeit bestand, dazu auch etwaige Besonderheiten der persönlichen Situation vorzubringen, die einer Arbeitsaufnahme bei objektiver Betrachtung entgegenstehen könnten.
Eine zivilisierte Gesellschaft garantiert ihren Mitgliedern das soziokulturelle Existenzminimum auch dann, wenn diese gesetzlich festgelegte Verhaltensnormen missachten. Das unterscheidet sie positiv von faschistischen und Militärdiktaturen, in denen drakonische Strafen und institutionalisierte Gewalt zum Alltag der Menschen gehören. Wenn das Gesetz zur Abschaffung des Bürgergeldes die Menschenwürde und das Sozialstaatsgebot des Grundgesetzes missachtet, folgt dem »Herbst der Reformen« ein Winter der sozialen Eiseskälte.
Prof. Dr. Christoph Butterwegge hat von 1998 bis 2016 Politikwissenschaft an der Universität Köln gelehrt und zuletzt die Bücher »Deutschland im Krisenmodus« sowie »Umverteilung des Reichtums« veröffentlicht.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.