- Politik
- Japan
Smartphone-Nutzung in Kleinstadt: Zwei Stunden täglich
Gegen exzessive Handynutzung will eine japanische Kleinstadt die Lösung gefunden haben: Den Konsum einfach verbieten

Als Karen Shimada zum ersten Mal von der neuen Regelung hörte, hielt sie das für einen Scherz. Rückblickend lacht sie ungläubig auf und blickt zum Himmel: »Nur noch zwei Stunden pro Tag?!«, rekapituliert die 18-Jährige nach Schulschluss am kleinen Bahnhof ihrer Heimatstadt. »Wie soll das gehen?« Sie war sicher: Es geht nicht. »Wenn ich aus der Schule komme, hab ich vom Hin- und Rückweg schon drei Stunden intus.« Ganztags nur zwei Stunden? Unmöglich.
Aber seit Anfang Oktober ist das, was Karen Shimada zuerst für einen Witz hielt, Realität. In Toyoake, einer Kleinstadt im Zentrum Japans, dürfen die 68 000 Einwohner pro Tag während ihrer Freizeit nur noch zwei Stunden lang ihr Smartphone nutzen. Karen Shimada trägt Jeans, hat einen gefransten Pony und eine Zahnspange. In der Hand: ein I-Phone der neuesten Generation. Sie kann es immer noch nicht fassen: »Im September erfuhr ich davon. Begriffen hab ich’s bis jetzt nicht so ganz.«
Es dürfte eine politische Neuheit sein, die im beschaulichen Ort Ende September den Stadtrat passierte. Zumindest in Japan ist Toyoake, das weder über eine große Industrie verfügt noch große Prominente hervorgebracht hat, hierfür nun landesweit bekannt geworden. Kaum ein Medium gibt es im Land, das sich noch nicht dazu geäußert hat. Kyodo, die führende Nachrichtenagentur, veröffentlichte ein Interview: »Bürgermeister verteidigt seine Zwei-Stunden-Smartphone-Richtlinie gegen viel Kritik«. »Yomiuri Shimbun«, die auflagenstärkste Tageszeitung der Welt, resümierte über die Maßnahme: »Sie sorgt für großen Aufsehen als Mittel, dem Problem der übermäßigen Nutzung elektronischer Geräte beizukommen.«
Smartphones sind zur Sucht geworden
Das Thema hinter Toyoakes neuer Handyschranke versteht so gut wie jede und jeder: Seit ihrer massenhaften Kommerzialisierung vor rund 15 Jahren sind Smartphones nicht nur zum Assistenten geworden, sondern auch zum Problem. Eine 2022 im akademischen Journal »Computers in Human Behavior« veröffentlichte Metastudie – eine Zusammenfassung mehrerer Studien – beobachtete ein global zunehmendes Auftreten von Smartphonesucht.
Eine ähnliche Studie im Journal »Clinical Psychology Review« bezifferte den Anteil jener, die die Kontrolle über die Nutzung ihres Geräts verloren haben, weltweit auf 27 Prozent. Mehr als jeder vierte Mensch neigte im Jahr 2022 demnach zu impulshaftem Griff zum Smartphone, dem er oft nicht widerstehen konnte. Im Jahr 2025 dürfte der Anteil noch höher liegen.
»Im September erfuhr ich davon. Begriffen hab ich’s bis jetzt nicht so ganz.«
Karen Shimada Schülerin
In Japan sieht die Lage auf den allerersten Blick nicht ganz so schlimm aus. Laut Daten der Regierung liegt die durchschnittliche Nutzungsdauer bei rund drei Stunden pro Tag. Wobei aber beachtet werden muss, dass im rapide alternden Land der Bevölkerungsanteil jener Menschen, die mindestens 65 Jahre alt sind, höher liegt als überall sonst in der Welt. Unter ihnen wiederum nutzen viele Menschen kein Smartphone. So kommen jüngere Menschen auf viel mehr Stunden pro Tag.
Bis zu sechs Stunden am Tag am Telefon
Am kaum frequentierten Bahnhof in Toyoake, hinter den Kontrollschranken, durch die sie mit ihrem Handy getappt ist, lacht Karen Shimada verlegen: »Täglich bin ich so ungefähr sechs Stunden am Gerät.« Sie zocke Games, schaue Videos auf Tiktok oder Youtube, schreibe mit Freunden über die in Japan dominierende Messaging-App Line, suche im Store nach neuen nützlichen oder spaßigen Apps. »Ich lerne aber auch für die Schule per Smartphone. Englischvokabeln zum Beispiel.«
Aber dass sie streng gegen diese neue Regel ist, die Menschen wie sie ganz besonders trifft, kann Karen Shimada nun auch nicht behaupten. »Es ist schon gut, dass etwas getan wird. Wir verschwenden ja wirklich oft unsere Zeit am Smartphone.« Eine Drosselung auf zwei Stunden wiederum sei brutal: »Wenn es doppelt so viel Zeit wäre, könnte ich damit noch leben.« Stattdessen bricht die Schülerin bisher einfach die Regeln. »Tja, mach ich halt«, sagt sie leise, zuckt mit den Schultern. Einfach so?
Zwei Kilometer westlich der Bahnstation, von der Karen Shimada nun zu Fuß – und gleichzeitig auf den Bildschirm blickend – nach Hause geht, sitzt Masafumi Kouki breitbeinig auf einem weichen Sessel. In seinem holzvertäfelten Besprechungszimmer nickt er verständnisvoll. »Es werden ja gar keine Strafen verhängt«, beruhigt der groß gewachsene Mann mit Nassrasur und schwarzem Anzug. »Ich will nur, dass die Leute, und zwar alle, anfangen, über ihr Verhältnis zu all den Geräten nachzudenken.«
Politik reagierte skeptisch auf die Verbotsidee
Masafumi Kouki ist seit mehr als zehn Jahren Bürgermeister von Toyoake. Die Idee, übermäßige Handynutzung einfach zu verbieten, kam ihm in diesem Jahr. »Ich habe zwei Kinder, sieben- und zehnjährig«, sagt Kouki. »Sie wollen auch ein Smartphone haben. Meine Frau und ich machen uns Sorgen, dass sie kaum einen gesunden Umgang damit finden werden. Wir alle nutzen es ja viel zu viel.« Er selbst schaue oft die Highlights der Hanshin Tigers, einer Baseballmannschaft aus Osaka. Seine Kinder beobachten das. Und wollen mitsehen.

Als Masafumi Kouki seine Verbotsidee im Sommer dem Gemeinderat vorstellte, stieß er zunächst vor allem auf Skepsis. So ein Eingriff in die Privatsphäre der Menschen sei viel zu tief, merkte ein Lokalpolitiker an. »Politischer Selbstmord«, mahnte eine andere. Je mehr der Bürgermeister aber betonte, dass er nur die Nutzung in der Freizeit begrenzen wolle, außerdem keine Bestrafungsmechanismen anstrebe, entstand ein Dialog. Ergebnis: Von 19 Stimmen votierten zwölf für das Verbot.
Und nicht nur Toyoake ist in der Sache geteilter Meinung. »Aus dem ganzen Land haben wir Zusendungen erhalten!«, erzählt Kouki amüsiert. »Wir haben sie alle ausgewertet: 60 Prozent davon waren gegen unsere Maßnahme. Aber viele davon hatten die Regel offenbar nicht richtig verstanden.« Denn sie seien davon ausgegangen, dass die Nutzung während der Arbeitszeit mitgezählt würde. »Schon das bloße Telefonieren zählen wir nicht«, betont Kouki. »Es geht nur um Screentime.«
Verbot soll zu mehr Kommunikation animieren
Der Mann, der von vielen verdammt worden ist, hat einen Punkt: Studien zeigen nämlich, dass Smartphones ähnlich süchtig machen können wie Alkohol oder Zigaretten, da die Nutzung vergleichbare Mengen Dopamin freisetzt. Eine von der Regierung in Auftrag gegebene Studie hat zudem ergeben, dass mehr Zeit am Bildschirm mit einem höheren Einsamkeitsrisiko und schlechterem Schlaf einhergeht. »Da muss man doch was tun«, meint der Bürgermeister.
Tony Nguyen findet das auch. Der 19-Jährige schlendert über die Straße, hat einen Rucksack über die rechte Schulter gehängt, ein Smartphone ist nicht zu sehen, aber er hat zwei. Der Vietnamese ist für einen Japanisch-Intensivkurs hergezogen, um später hier zu studieren. »Zwei Stunden pro Tag dürfen kein Problem sein«, sagt er energisch. »Die älteren Leute lesen Zeitung, das können wir doch auch. Und gelernt haben sie mit Zettel und Stift. Das funktioniert sogar besser.« An ihnen will er sich ein Beispiel nehmen.
Aber die meisten Menschen im Ort scheinen es eher wie Karen Shimada zu machen, die diese kaum kontrollierbare Regel einfach heimlich missachtet. In der Bahn, die zwei Haltestellen innerhalb von Toyoake mit der Großstadt Nagoya verbindet, halten in einem Abteil von zwölf Passagieren neun ihr Handy in der Hand, sechs davon schauen drauf. Eine Station später sind einige ausgestiegen, andere eingestiegen, aber das Verhältnis bleibt in etwa gleich.
Bei einem anderen Bahnhof im Ort befragt Maho Yatsukawa vor einer Einkaufspassage Passanten. »Wie vergnügt sich die Jugend von Toyoake – jetzt ganz ohne Smartphone?« Er hat eine Kamera dabei. Für den Regionalsender Chukyo TV bereitet der 43-Jährige eine humorige Sendung vor. Aber insgeheim ist es auch ihm ernst: »Ich selbst starre jeden Tag neun Stunden auf das Ding, gucke da Fußball und alles«, flüstert er in einem ruhigen Moment. »Meinen Fünfjährigen hab ich damit auch schon angesteckt.«
Zuspruch ja, befolgen nein
Je mehr man sich in Toyoake umhört, desto mehr Zuspruch scheint diese neue Regel zu finden, auch wenn die meisten sie gar nicht befolgen. In einem Kissaten, einer Art Tee- und Kaffeehaus aus den Nachkriegsjahrzehnten, ist die Betreiberin ins Grübeln gekommen. »Das Argument verstehe ich«, sagt die schmächtige 84-Jährige, während sie Kaffee aufbrüht. »Wenn das Verbot für die ganze Familie gilt, ziehen die Kinder eher mit.«
Aber was sei mit Menschen wie ihr? Die alte Dame, die ihren Namen nicht verraten möchte, hat kein Smartphone. Und zwei Kundinnen, die zur Mittagszeit zu Kaffee und Kuchen gekommen sind, auch nicht. »Uns müssten sie das Fernsehen verbieten!«, ruft die Wirtin. Grundschulkindern legt die Stadtverwaltung jetzt nahe, ab 9 Uhr abends kein Smartphone mehr in der Hand zu haben, im Mittelschulalter soll um zehn Schluss sein. »Und ich sitze den ganzen Abend vorm TV«, stimmt eine Besucherin ein. »Wir brauchen auch Verbote!« Aber sie winkt ab: »Ohne Strafen funktionieren solche Regeln sowieso nicht.«
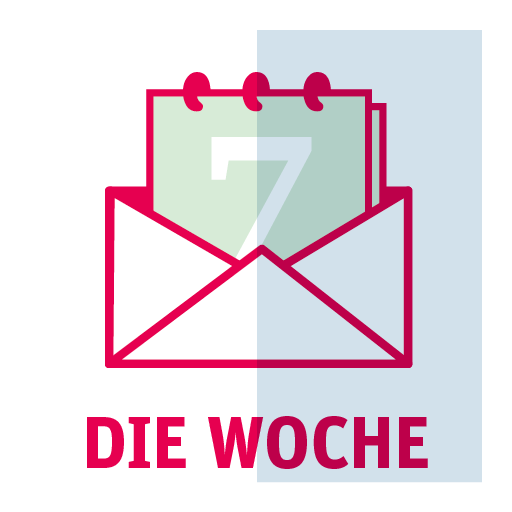
Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Wenn nun das alles tatsächlich nichts bringt und die Smartphone-Nutzungsdauer nur weiter steige, statt zu fallen? Hätte sich Masafumi Kouki, der im Jahr 2027 womöglich wiedergewählt werden möchte, dann mit seiner schier nicht durchzusetzenden Maßnahme politisch lächerlich gemacht? Der Bürgermeister, der bisher keine interessierten Anfragen von Amtskollegen erhalten hat, sieht das anders: »Es ist doch super, wenn wir eine Debatte anstoßen können.«
Außerdem habe Toyoakes neue Berühmtheit einen anderen erfreulichen Effekt: Bisher war der Ort derart unbekannt, dass Fremde die chinesischen Schriftzeichen, mit denen sich Toyoake schreibt, meist als »Houmei« aussprachen – eine gängige Lesart dieser Zeichenkombination. »Ständig mussten wir die Leute korrigieren: Nicht Houmei! Toyoake heißen wir.« Das sei nun endlich nicht mehr nötig. Masafumi Kouki wirkt fast prahlerisch: »Wer wir sind und wie man uns ausspricht, ist jetzt Allgemeinwissen.«
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.







