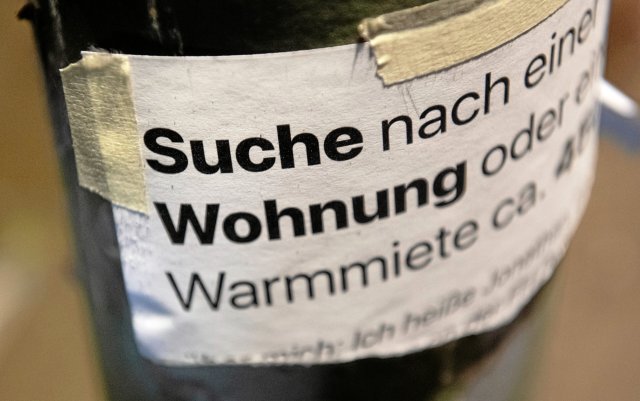- Politik
- Südamerika
Chile: Kampf um eine bessere Zukunft
Chiles Linke steht nach vier Jahren Minderheitsregierung vor schwierigen Wahlen

Bei den Umfragen liegt sie zwar vorne, die Chancen auf die Präsidentschaft in Chile sind dennoch gering: Denn obwohl die linke Bündniskandidatin Jeannette Jara von der Kommunistischen Partei Chiles in allen Meinungserhebungen führt, scheint das Erreichen einer absoluten Mehrheit für die ehemalige Arbeitsministerin der scheidenden links-progressiven Regierung in der ersten Runde am 16. November ausgeschlossen. Und in der Stichwahl wird sie es gegen einen Kandidaten von ultrarechts, von denen drei in den Umfragen auf Jara folgen, schwer haben.
Noch regiert in Chile ein linker Präsident: Gabriel Boric. Trotz des relativ knappen Wahlergebnisses und fehlender linker Parlamentsmehrheit begann die Regierungszeit des Präsidenten von der Linkspartei Frente Amplio (Breite Front) Anfang 2022 mit großer Dynamik. Gewonnen hatte Boric die Wahl im Zuge des Aufschwungs einer Protestbewegung gegen das neoliberale Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, das die »Chicago Boys« um Milton Friedman einst zur Zeit der Militärdiktatur (1973–1990) eingeführt hatten.
Im November 2019 unterzeichneten dann die maßgeblichen politischen Kräfte ein »Abkommen für sozialen Frieden und eine neue Verfassung«. Um die alte Verfassung aus der Zeit der Diktatur zu ersetzen, sollte ein Verfassungskonvent eine neue ausarbeiten. Bei der Wahl dieses Konvents siegten die linken und progressiven Kräfte deutlich, die Rechte verfehlte sogar die Sperrminorität von 33 Prozent.
Scheitern des Verfassungsreferendums
»Die Regierung Boric trat mit vielen Reformversprechen an; aufgrund der fehlenden Parlamentsmehrheit bestand die Strategie darin, mit den wichtigsten Vorhaben auf das Referendum zur Annahme der neuen Verfassung im September 2022 zu warten. Die Reformen gingen Hand in Hand mit Elementen aus dem Verfassungsvorschlag, und das Kalkül war, sie im Zuge der massiven öffentlichen Zustimmung zur neuen Verfassung dann auch durch das Parlament zu bekommen«, sagt Pierina Ferretti, Präsidentin von Nodo XXI, dem Thinktank der Frente Amplio. Doch diese Rechnung ging nicht auf, weil der Verfassungsentwurf beim Referendum keine Mehrheit fand. Seither befindet sich die Boric-Regierung in der Defensive, ihre Erfolgsbilanz fällt dürftig aus.

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung unterhält mehr als zwei Dutzend Auslandsbüros auf allen Kontinenten. Im Rahmen eines Kooperationsprojektes mit »nd« gibt es an dieser Stelle regelmäßig Berichte über Entwicklungen in den verschiedensten Regionen. Alle Texte auf: dasnd.de/rls
Der wichtigste Profiteur der Niederlage war José Antonio Kast, der die Ablehnungskampagne unter dem Motto »Rechazo« (Ich lehne ab) anführte. Er steht in enger Verbindung mit der ultrarechten spanischen Vox und der AfD; bereits bei der Wahl 2021 war der Deutsch-Chilene Sven von Storch, der Ehemann der AfD-Politikerin Beatrix von Storch, sein außenpolitischer Berater. Während der Verfassungskonvent neun Monate lang die 388 Artikel des Entwurfs debattierte, konzentrierte sich die Rechte auf eine effektive Desinformationskampagne. Mit millionenschwerer Unterstützung von Unternehmen und den reichsten Familien Chiles wurden falsche Behauptungen – so etwa, dass Wohneigentum verboten werden solle – in den Vordergrund gerückt. Auch die geplante Ausweitung von Rechten der indigenen Bevölkerung und der Frauen wurde diffamiert.
Beim Referendum galt erstmals seit 2009 wieder eine Wahlpflicht, weshalb statt der üblichen 50 Prozent diesmal 86 Prozent aller Wahlberechtigten abstimmten. »Die neuen Wähler*innen kamen vor allem aus den ärmsten Sektoren der Gesellschaft. Da der Verfassungsvorschlag ihre Lebensbedingungen verbessern sollte, dachten wir, sie wären automatisch auf unserer Seite. Das war ein Fehler«, konstatiert Ferretti.
Bei der Neuwahl des Verfassungskonvents im Mai 2023 kam es dann zu einem Erdrutschsieg der Rechten, die 33 der 50 Sitze gewannen. Sie präsentierten später einen Verfassungsentwurf, der die sozialen Grausamkeiten der seit 1980 geltenden Pinochet-Verfassung noch in den Schatten stellte. Aber auch für diesen Vorschlag fand sich beim folgenden Referendum keine Mehrheit, weshalb die Pinochet-Verfassung weiterhin gilt.
»Die fünf Millionen Neuwähler, die bisher vom politischen System ausgeschlossen waren, haben den Ideen der Linken und Rechten in diesen beiden Referenden eine deutliche Abfuhr erteilt«, erklärt Fernando Carmona, Präsident von ICAL (Instituto de Ciencias Alejandro Lipschütz), dem Thinktank der KP Chiles. »Nach der Niederlage im Referendum sind dann die Konflikte im Lager der Regierungskoalition von Boric in den Vordergrund getreten.«
Verbesserungen nur im Kleinen
Die Ablehnung des linken Verfassungsentwurfs schwächte die Regierung nachhaltig. Sie scheiterte anschließend im Parlament auch mit ihrer Steuerreform. Damit fehlte jedoch das Geld zur Finanzierung sozialpolitischer Reformen. Dennoch gab es unter der Regierung Boric auch Erfolge zu verzeichnen. So trat Chile dem Escazú-Abkommen für demokratische Beteiligungsrechte in Umweltfragen bei, die staatliche Kontrolle des Lithium-Abbaus wurde zumindest diskutiert.
Den größten Erfolg sieht Fernando Carmona bei Initiativen der KP-geführten Ministerien, so beispielsweise der »Suchplan«, ein Werkzeug zur Durchsetzung der Menschenrechte für Angehörige von Verschwundenen und Opfern der Diktatur sowie die Prestigeprojekte aus dem von Jeannette Jara geführten Arbeits- und Sozialministerium: die Erhöhung des Mindestlohns von umgerechnet knapp 300 Euro auf nun über 500 Euro, eine kleine Rentenreform sowie eine schrittweise Arbeitszeitverkürzung von 45 auf 40 Wochenstunden.
»Richtig unter Druck geraten sind wir bei den Themen Migration und Sicherheit. Mittlerweile sind eine Million von 18 Millionen Menschen in Chile Migranten, das bedeutet Stress für das soziale und politische System, insbesondere in den Grenzstädten. Veritable politische Antworten gibt es darauf bisher nicht; die Rechte will illegal und planlos deportieren, die Linke setzt eher auf freien Transit. Wir müssen aber Entscheidungen aufgrund von Daten treffen, um die Sozialsysteme zu erhalten«, so Carmona. Pierina Ferretti sieht ebenfalls ein Defizit beim Thema Sicherheit: »In der Regierung waren wir nicht vorbereitet auf die Welle brutaler Gewalt, mit der die organisierte Kriminalität das Land überzogen hat. Die Polizei war damit überfordert, und in der Politik fehlte der Diskurs, fehlten Antworten darauf.«
Die Fundación Sol (Stiftung Sonne), ein unabhängiges, gewerkschaftsorientiertes Wirtschaftsinstitut, hat die Sozialmaßnahmen untersucht. Das Urteil fällt ernüchternd aus. »Natürlich ist es positiv, mehr Zeit zur Selbstverwirklichung zu haben. In den kommenden Jahren sinkt die Arbeitszeit in der Woche graduell pro Jahr um eine Stunde von 45 auf 40 Stunden, und zwar so, dass die Unternehmen nicht mit Pausenreduktion tricksen können. Aber leider bezahlen die Beschäftigten das mit extremer Flexibilisierung«, urteilt Maria José Azocar, Ökonomin der Stiftung.
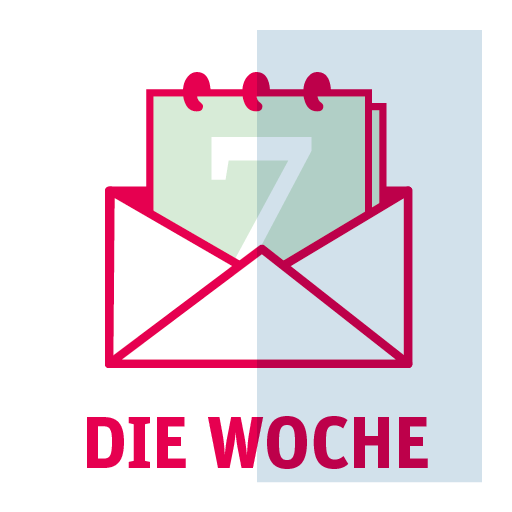
Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Im privaten Rentensystem Chiles wurde ein neuer staatlicher Bonus eingeführt, der vor allem die Situation von Frauen etwas verbessert. Aber im Kleingedruckten versteckt sich eine Laufzeit von 30 Jahren, danach obliegt alles wieder der privaten Alterssicherung. »Diese Maßnahmen helfen nicht, die Ungleichheit in Chile zu vermindern. Das Bruttoinlandsprodukt stieg in den vergangenen zehn Jahren um fast 20 Prozent, die Löhne jedoch nur um 6,6 Prozent. In Chile konzentriert sich die Hälfte des Reichtums auf ein Prozent der Bevölkerung.«
Aus Azocars Sicht sind drei wichtige Reformen nicht hinreichend behandelt worden, nämlich die Regulierung von Subunternehmen – bei denen in Chile acht von zehn Beschäftigten angestellt sind –, die Steuerreform und das Gesetz für die Aushandlung von Branchentarifverträgen. Denn so atomisiert wie in Chile sind Gewerkschaften und ihre Rechte in kaum einem anderen Land: Es gibt mehr als 9000 Gewerkschaften, von denen die Hälfte nicht einmal 50 Mitglieder hat. Tarifverhandlungen finden auf Mikroebene in Betriebsteilen statt. »Mit diesem Gesetz hätte die Gewerkschaftsbewegung in Chile gleich am Anfang massiv gestärkt werden können und die Regierung einen wertvollen Bündnispartner gewonnen, um dann etwa die Steuerreform effektiver voranzutreiben. Das war leider schlecht gemacht«, sagt Azocar.
Obwohl Boric mit dem Slogan »Wallmapu Libre« (Freiheit für das Land der Mapuche) angetreten war, gelang es seiner Regierung überdies nicht, ernsthaft mit den indigenen Völkern zu verhandeln. Bereits kurz nach Regierungsantritt scheiterte eine Vermittlungsmission der Innenministerin im Mapuche-Territorium. Der Mapuche-Aktivist Calfullan kritisiert: »Boric und seine Leute haben das nur idealistisch gesehen. Aber die Mapuche fordern mehr als das Recht auf ihre Sprache und Kultur. Wir fordern unsere durch frühere Regierungen und Unternehmen enteigneten Territorien zurück.«
Kommt die Rechtsregierung?
Wie kann der Rechtsruck in Chile gestoppt werden? Sollte Jara bei der Präsidentschaftswahl scheitern, setzt ihre Wahlallianz aufs Parlament. Da das chilenische Wahlrecht große Bündnisse bevorzugt, haben sich alle moderaten und linken Parteien auf eine Einheitsliste geeinigt. »Damit können wir einem rechten Präsidenten das Regieren erschweren«, hofft Ferretti.
Gleichzeitig hat mit Kast jedoch der wichtigste Herausforderer aus dem rechten Lager bereits angekündigt, das Parlament künftig aushebeln zu wollen. Und in den Umfragen folgen auf den zweitplatzierten Kast zwei weitere Kandidat*innen der Ultrarechten: Evelyn Mattei von der Rechtspartei UDI, stolze Tochter eines Pinochet-Generals, die die Opfer der Diktatur als »notwendig« bezeichnete, sowie Johannes Kaiser, Gründer der National-Libertären Partei, der sich als chilenische Version des argentinischen Kettensägen-Präsidenten Javier Milei geriert.
Für den Kommunisten Carmona ist die Wahl aber noch nicht entschieden: »Der einzige Weg, die Ultrarechten zu stoppen, ist es, einen Vorschlag zur Verbesserung der Lebensbedingungen der fünf Millionen Neuwähler zu machen, die zu den Verlierern des Neoliberalismus gehören und keine Möglichkeit haben, diesen Umständen zu entkommen. Die Rechte träumt von einer besseren Vergangenheit, die es nicht geben kann. Wir kämpfen für eine bessere Zukunft.
Torge Löding leitet das Regionalbüro Cono Sur der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Buenos Aires.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.