- Kommentare
- »Zielbild«
Digitalministerium: Viel Lärm um nichts
Karsten Wildberger will bei der Digitalisierung alles besser machen
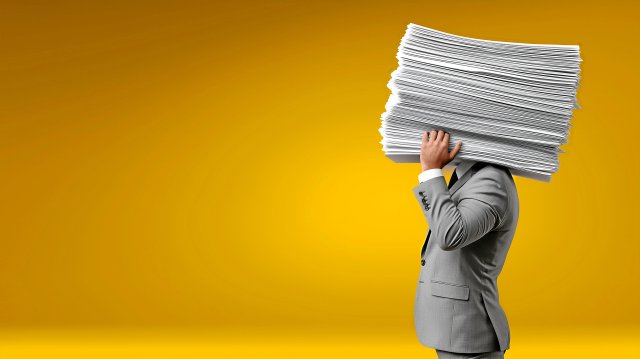
Ich weiß nicht, ob es in anderen Politikbereichen auch so ist, aber in der Digitalpolitik grüßt das sprichwörtliche Murmeltier seit vielen Jahren mit sehr ähnlich klingenden Ankündigungen. Da nehmen sich die wechselnden regierenden Parteien wenig: Es muss schneller gehen, digitaler werden, moderner, und überhaupt soll Deutschland endlich wieder vorne mitspielen, so wie früher.
Letzte Woche gab das neue Digitalministerium sein »Zielbild« bekannt. »Wir brauchen einen Durchbruch für Deutschland«, heißt es da. Ein*e Schelm*in, wer sich an Roman Herzogs »Durch Deutschland muss ein Ruck gehen«-Rede erinnert fühlt. Der sagte 1997, also vor fast 30 Jahren: »Es geht um nichts Geringeres als um eine neue industrielle Revolution, um die Entwicklung zu einer neuen, globalen Gesellschaft des Informationszeitalters. Der Vergleich mit Amerika und seinem leergefegten Arbeitsmarkt zeigt: Deutschland droht tatsächlich zurückzufallen.«
Tja. Bisher ist das mit der Entwicklung so mittelgut gelaufen, aber immerhin haben wir jetzt ein Ministerium für diese Angelegenheiten. Worin es sich deutlich von den vorher Zuständigen unterscheidet: Es wird weniger Wert auf die Form gelegt. Vielleicht ein Zeichen dafür, dass jetzt wirklich in die Hände gespuckt wird? Im »Zielbild« sind gleich eine ganze Handvoll entzückender Schreibfehler drin. Um nur ein Beispiel zu nennen: »Siebentens«. In den sozialen Netzen entspann sich direkt eine Diskussion, ob die Fehler vielleicht im Text blieben, um dem Eindruck vorzubeugen, das ganze Werk sei von ChatGPT geschrieben. Der könnte nämlich bei so schönen Sätzen entstehen wie diesem: »Deutschland hat die nächsten Jahre die einmalige Gelegenheit, Deutschland zu dem zu machen, was Deutschland sein kann. Auch innerhalb Europas.« Was will uns Digitalminister Wildberger sagen?

Anne Roth gehört zu den Pionierinnen linker Netzpolitik. Für »nd« schreibt sie jeden ersten Montag im Monat über digitale Grundrechte und feministische Perspektiven auf Technik.
Das neue »Zielbild« bleibt erstaunlich vage. Unter »Sechstens« erfahren wir: »Der neue Politikstil des BMDS ist die ›Projekte-Politik‹: konkret, schnell, messbar, erfolgreich.« Das ist so unkonkret wie es nicht neu ist. Die Idee, ihre Digitalpolitik in Projektform zu organisieren, hatte auch schon die letzte Bundesregierung. Um die Bedeutung zu unterstreichen, hießen manche »Leuchturmprojekte«, jetzt sind es eben »Durchbruchsprojekte«. (Vielleicht hätte sich der neue Minister mal mit seinem Vorgänger unterhalten oder wenigstens dessen Unterlagen lesen sollen, ein paar sind bestimmt noch da.) Die vorherige Koalition war sprachlich noch etwas spröder und verpackte ihre Pläne als »Umsetzungsstrategie Digitalisierung gestalten«.
Aus »Leuchtturmprojekten« werden »Durchbruchsprojekte«
Die Umsetzung stockte jedes Mal trotz aller schwungvollen Sprache, und so wurden es von Regierung zu Regierung weniger Projekte. Die letzte GroKo, also die vorletzte Bundesregierung, hatte in ihrer »Umsetzungsstrategie« noch 130 »zentrale digitalpolitische Vorhaben«, bei der Ampel gab es eine »Digitalstrategie« mit »Projekten, von deren Umsetzung die größte Hebelwirkung zu erwarten ist« und außerdem 19 der schon erwähnten »Leuchtturmprojekte«.
Von den neuen »Durchbruchsprojekten« im »Zielbild« gibt es lediglich acht, und es wäre erwartbar, dass die dafür einigermaßen konkret sind, nach Definition der »neuen« Projektepolitik. Doch was findet sich da? Zum Beispiel das Ziel »Flächendeckendes, sicheres Highspeed-Internet und 5G machen Stadt und Land gleichwertig«. Hui, das ist mal wirklich originell. Daran sind bisher noch alle fürs Digitale zuständigen Ministerien gescheitert, aber es wäre schon schön, wenn’s dann jetzt klappte. Wie das gemacht werden soll und was das Neue dabei ist – dazu steht leider nichts im Text.
Ein anderes altes Digitalthema, das bei den Zielen ausgespart wurde und das zugrundeliegende Problem aber gut verdeutlicht, wird sicher auch in dieser Legislatur weiter eine Rolle spielen: die »IT-Konsolidierung des Bundes«. Das ist das Vorhaben, die IT-Ausstattung von Ministerien und Behörden zu standardisieren, weil das die Zusammenarbeit der verschiedenen Stellen (hoffentlich) erleichtert und nebenher auch günstiger und sicherer wäre, als überall undurchschaubare kleine Software-Zoos am Leben zu erhalten.
An diesem (unfassbar teuren) Projekt arbeiten die verschiedenen Bundesregierungen inzwischen seit ganzen zehn Jahren, und es ist noch lange nicht beendet. Das hat vielleicht hier und da mit Unfähigkeit von Beteiligten zu tun, aber es zeigt eben auch, dass es schwierig ist, solche komplexen und nach und nach entstandenen Strukturen umzubauen und zu vereinheitlichen. Unwahrscheinlich, dass ein bisschen Hauruck-Rhetorik daran viel ändert.
Dabei könnte gerade dieses Thema ein Paradebeispiel dafür sein, wie der neue Minister das Thema »Staatsmodernisierung« angehen will, für das er neben der Digitalpolitik zuständig ist. Was könnte den Staat besser modernisieren als eine stabile und sichere IT-Struktur, die halbwegs auf dem Niveau der Zeit angekommen ist und den Beamt*innen ermöglicht, unkompliziert und über verkrustete Hierarchien hinweg digital zusammenzuarbeiten? Ohne vorher alles ausdrucken und per Aktenmappe über zehn Schreibtische hin- und wieder zurückschleusen zu müssen, um irgendwas zu verändern.
Wenig für Menschen, viel für Unternehmen
Auf den ersten Blick ist nicht so leicht erkennbar, was Digitalpolitik überhaupt mit Staatsmodernisierung zu tun hat und warum beide Themen in einem Ministerium gelandet sind. Vermutlich steckt dahinter die Vorstellung, dass beides irgendwie dazu beitragen soll, dass alles besser und schneller geht. In dem Zusammenhang fällt gerade auch sehr häufig die Vokabel »Entbürokratisierung«. Klingt gut, denn wer ist nicht davon genervt, immer wieder dieselben Formulare mit den immer selben Daten auszufüllen?
Wenn die neuen Digitalisierungsmaßnahmen dazu führten, dass es für Menschen einfacher würde, Behördenangelegenheiten zu erledigen, wäre das großartig. Wir würden so viel Zeit und Nerven sparen.
Wenig überraschend geht es dieser Koalition aber vor allem um Verbesserungen für Unternehmen. Im »Zielbild« des Digitalministers geht es um Wettbewerbsfähigkeit, um Zukunftstechnologien, Digitalwirtschaft, um die Abschaffung von Regeln, damit es Unternehmen einfacher haben. Ein einziges von den zehn Zielen befasst sich mit Menschen und wie ihr Alltag durch funktionierende Digitalisierung einfacher werden soll. Erwartbar ist, dass weniger Regeln und Dokumentationspflichten für Unternehmen vielen Menschen das Leben nicht einfacher, sondern schwerer machen: Wenn die Verletzung von Arbeitsrechten oder Umweltstandards, wenn Diskriminierungen schwerer nachweisbar sind, weil nirgends steht, warum welche KI so und nicht anders entschieden hat, ist das für die Unternehmen vielleicht günstiger und bequemer, aber für die Gesellschaft ein enormer Rückschritt. Eine sinnvolle Modernisierung und Digitalisierung würde erstmal mehr und nicht weniger Aufwand mit sich bringen: Es müsste sichergestellt sein, dass alle Menschen die Veränderungen verstehen und in die Lage versetzt werden, sie nutzen zu können. Digitalisierung müsste aus der Perspektive derjenigen gedacht werden, die sie benutzen.
Aktuell haben wir eine Situation, in der alle Behörden und Unternehmen auf eigene Faust herumexperimentieren und das offensichtlich zuerst mit dem Ziel, Personal einzusparen. Mit dem Effekt, dass es viel schwieriger geworden ist, realen Menschen Fragen zu stellen, während gleichzeitig ständig neue Online-Formulare auftauchen und für die Nutzer*innen häufig schwer vorhersehbar ist, wo diese digitale One-Way-Kommunikation eigentlich landet. Mehr Digitalisierung und auch die Modernisierung des Staates wären so sinnvoll, wenn sie nachvollziehbar, transparent und das Ergebnis gut benutzbar wäre. Leider sieht es danach nicht aus.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.






