- Politik
- Psychische Leiden
Wahnsinn und Widerstand
Wie »Einer flog über das Kuckucksnest« die Psychiatrie-Debatte veränderte – und warum sie bis heute nicht verstummt ist

Randle McMurphy liegt reglos im Bett. Sein Blick leer, die Augen glasig. Kein Schrei, kein Wort. Der Unbeugsame, der zuvor das Kliniksystem herausgefordert hat, ist verstummt – ein seelenloser Körper. Bei ihm wurde eine Lobotomie durchgeführt. Dabei durchtrennen Ärzte Nervenbahnen im Gehirn, um sogenanntes deviantes Verhalten zu unterbinden – jahrzehntelang eine gängige Praxis in der Psychiatrie, oft ohne Zustimmung der Betroffenen. So endet Miloš Formans Filmklassiker »Einer flog über das Kuckucksnest«, der am 19. November 1975 uraufgeführt und ein Jahr später mit fünf Oscars ausgezeichnet wurde – darunter für Jack Nicholson und Louise Fletcher als beste Hauptdarsteller.
Die Tragikomödie war ein Schock für das Publikum. Forman brachte auf die Leinwand, was bis dahin hinter Klinikmauern der Öffentlichkeit verborgen geblieben war: die Disziplinierung des Abweichenden. Eine Institution, die Heilung versprach, aber Kontrolle und Zwang ausübte – ein Ort, an dem das Subjekt verschwand. In der Figur der Oberschwester Ratched verdichtete sich das Machtgefüge eines ganzen Systems, das sich fürsorglich verstand und zugleich vernichtend wirken konnte.
Regisseur Forman inszenierte die Geschichte in einem fast dokumentarischen Stil: Viele Szenen entstanden in einer echten psychiatrischen Klinik, einige Darsteller waren selbst Patienten. Im Film werden sie vom Anstaltspersonal fortwährend mit Medikamenten ruhiggestellt und mit Elektroschocks behandelt. Das Drehbuch beruhte auf dem gleichnamigen Roman von Ken Kesey.
Der US-amerikanische Schriftsteller erzählt die Geschichte des Kleinkriminellen und Sexualstraftäters Randle McMurphy, der sich in eine psychiatrische Klinik einweisen lässt, dem Kuckucksnest, um einer Gefängnisstrafe zu entgehen. Anfangs wirkt er wie ein Einzelgänger, der nur seine Ruhe haben will. Doch schnell wird er zum Unruhestifter. Er organisiert Kartenspiele, schmuggelt Alkohol und Prostituierte in die Abteilung, überzeugt die Mitpatienten, ein Baseballspiel im Fernsehen anzuschauen und ermutigt sie, eigene Entscheidungen zu treffen.
Kesey arbeitete Anfang der 1960er-Jahre im kalifornischen Menlo Park Veterans Hospital – nachts als Pfleger, tagsüber als Versuchsperson an staatlich finanzierten Forschungsversuchen mit LSD und Psychedelika. Er erkannte allmählich, dass »das Irrenhaus« weniger ein Ort der Heilung als eine Bühne gesellschaftlicher Ausgrenzung war. Sein Roman von 1962 wurde so zu einer Parabel auf ein System, das den Wahnsinn erzeugt, den es zu heilen vorgibt.
Miloš Forman, aus der kommunistischen Tschechoslowakei in die Vereinigten Staaten emigriert, verstand die Mechanik der Macht aus eigener Erfahrung. »Man sieht in fast jeder Einstellung ein Gitter, eine versperrte Tür«, sagt Daniel Vitecek. Der Wiener Humanmediziner beschäftigt sich u.a. mit der Darstellung von Psychiatrie in der Kunst. »Forman wusste aus eigener Erfahrung, wie totale Institutionen und Unterdrückung funktionieren.«
Der Aufstand im weißen Kittel
Als der Film in die Kinos kam, tobte die Debatte. Was bedeutet Heilung? Wer bestimmt, was »normal« ist? Darf man Menschen gegen ihren Willen behandeln oder einsperren? Es war die Zeit der neuen sozialen Bewegungen. Die Gesellschaft diskutierte über Autorität, Gewalt, Freiheit – und auch die Psychiatrie wurde zum Prüfstein sozialer Reformen.
Psychiatrische Kliniken waren vielerorts geschlossene Welten: lange Flure, Gitterbetten, Fixierungen, Elektroschocks. Viele Menschen verschwanden hinter Anstaltsmauern – und blieben dort verwahrt. Anfang der 1970er Jahre steckte die Anstaltspsychiatrie in den westlichen Industrieländern in einer Sackgasse: eine halbe Million Patientinnen und Patienten in den USA, rund 117 000 in Deutschland und knapp 80 000 in Italien.
Was sich damals als »Antipsychiatrie« formierte, war keine geschlossene Bewegung, sondern ein Netzwerk von Menschen, die Reformideen hatten. »Antipsychiatrie«, sagt der Düsseldorfer Medizinhistoriker Heiner Fangerau, »ist ein Sammelbegriff, der viele unterschiedliche Strömungen umfasst. Gemeint ist stets die Infragestellung einer Psychiatrie, die über Menschen urteilt, anstatt sie zu verstehen.«
Der Soziologe Erving Goffman kritisierte die Anstalten als eine totale Institution, in der Menschen ihre Individualität verlieren und vollständig der Logik des Systems unterworfen werden. In Italien trat der Psychiater Franco Basaglia als entschiedener Gegner geschlossener Kliniken auf. Sein Ziel: die Schließung zugunsten einer ambulanten oder teilstationären, gemeindenahen Psychiatrie, die Betroffenen helfen sollte, ein Leben mit größtmöglicher Selbständigkeit in vertrauter Umgebung zu führen.
In Großbritannien experimentierten Ärzte wie Ronald Laing mit alternativen Wohnprojekten, in denen Patientinnen und Patienten gemeinsam mit Therapeuten lebten. »Die Antipsychiatrie schließt sich der 68er-Bewegung an«, erklärt Vitecek. »Einerseits radikal politisch, andererseits praktisch orientiert. Viele ihrer Vertreter begannen, in Kliniken zu arbeiten und neue Therapieformen zu erproben.« Freiheit heilt – so stand es an den Mauern der psychiatrischen Klinik in Triest, die Basaglia mehrere Jahre lang leitete.
Manche gingen noch weiter. Das Sozialistische Patientenkollektiv (SPK) in Heidelberg verstand Krankheit als Form des Protestes gegen die kapitalistische Ordnung. »Aus der Krankheit eine Waffe machen«, lautete ein Buchtitel des SPK im Jahr 1972. Es illustriert die Grenzauflösung zwischen Therapie und Ideologie. Doch diese Fundamentalkritik birgt auch Gefahren. »Wer radikal deinstitutionalisiert, nimmt Menschen im Extremfall auch die Chance auf Hilfe«, mahnt Fangerau. »Viele, die man befreien wollte, fanden sich später obdachlos auf der Straße wieder.«
Der Schock der Wissenschaft
1969 führte der US-Psychologe und Sozialwissenschaftler David Rosenhan ein vermeintlich bahnbrechendes Experiment durch, das die Zuverlässigkeit psychiatrischer Diagnosen infrage stellte: Unter falschen Namen und mit erfundenen Symptomen ließen sich acht gesunde Probanden in verschiedene psychiatrische Krankenhäuser einweisen. Die Scheinpatienten verhielten sich nach der Aufnahme normal und kooperativ. Dennoch wurden sie teils über Wochen hinweg behandelt, obwohl sie während des Aufenthaltes angaben, die Symptome seien verschwunden.
»Im Schnitt hatten die Patienten sechs Minuten Kontakt mit dem Personal am Tag«, berichtete Rosenhan später in einem Interview. »Psychiatrische Kliniken sind Orte für Menschen, die die Gesellschaft nicht mehr haben will.« Rosenhan veröffentlichte seine Ergebnisse 1973 in der renommierten Fachzeitschrift »Science« und sorgte für heftige Kontroversen. Fachkollegen warfen ihm methodische Mängel vor – die öffentliche Wirkung jedoch war enorm. Wenn selbst Gesunde als Kranke gelten konnten, wie verlässlich war dann psychiatrische Diagnostik überhaupt?
2019 griff die US-Journalistin Susannah Cahalan Rosenhans Experiment in ihrem Buch »The great pretender« (Die große Täuschung) erneut auf – basierend auf Rosenhans Nachlass. Sie konnte nur drei der acht angeblichen Probanden identifizieren: Rosenhan selbst und zwei seiner Studierenden. Cahalans Vorwurf: Rosenhan habe Daten manipuliert, Teilnehmer erfunden und seinen Artikel mit Falschaussagen versehen. Das Paradoxe, bilanziert die Autorin: Während Rosenhan an der Wahrheit drehte, stieß seine Studie dennoch wichtige Reformen an.
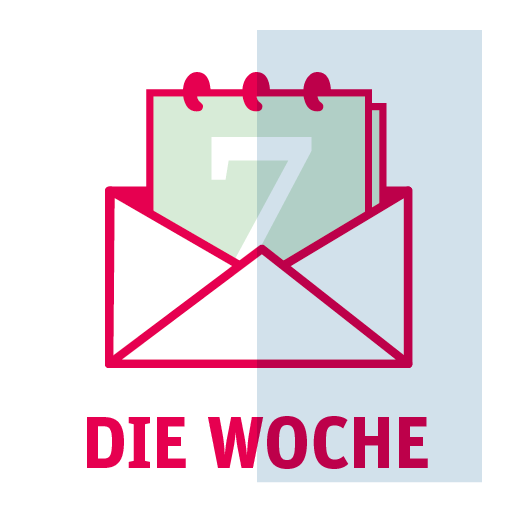
Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Auch in der Bundesrepublik hatten sich die Zustände in den psychiatrischen Großanstalten über Jahrzehnte verfestigt. 1971 setzte der Bundestag eine Enquête-Kommission ein, die die Versorgungslage in der Psychiatrie untersuchen sollte. Der Abschlussbericht von 1975 war ein Paukenschlag: Er dokumentierte menschenunwürdige Zustände, überfordertes Personal, fehlende Therapieangebote – und forderte eine radikale Neuordnung.
»Die Ergebnisse der Enquête waren Wasser auf die Mühlen all derjenigen, die auf Veränderung hofften«, erinnert sich Rainer Richter, Psychotherapeut und ehemaliger Präsident der Bundespsychotherapeutenkammer. »Plötzlich wagten auch Chefärzte neue Konzepte wie die therapeutische Gemeinschaft einzuführen.« Tageskliniken, betreute Wohngruppen, sozialpsychiatrische Dienste – vieles, was heute selbstverständlich erscheint, geht auf diese Reformjahre zurück. »Das war ein Kompromiss zwischen Antipsychiatrie, sozialer und etablierter Psychiatrie«, bilanziert Medizinhistoriker Fangerau.
Doch nicht alle Empfehlungen wurden umgesetzt. Gerade in ländlichen Regionen blieben Lücken, während forensische Kliniken und geschlossene Abteilungen wuchsen. Heute entlässt die Psychiatrie Menschen aus der Behandlung, ohne dass sie geheilt seien, bemerkt Fangerau. »Die Tür der Psychiatrie wird zur Drehtür zwischen Entlassung, Krise und erneuter Aufnahme.«
Vom Aufstand zur Selbstoptimierung
»Einer flog über das Kuckucksnest« traf einen Nerv – nicht nur, weil der Film Missstände aufzeigte, sondern auch, weil er den Begriff des Wahnsinns politisierte. Das Individuum im Widerstand gegen die Anstalt wurde zur Metapher einer ganzen Generation. Seitdem hat sich die Psychiatrie verändert – doch die Fragen, die der Hollywood-Streifen aufwarf, sind geblieben: Was ist normal? Wer darf darüber entscheiden? Was geschieht mit denen, die anders sind?
Randle McMurphy überlebt im Film die geschlossene Abteilung nicht. Doch sein Aufbegehren bleibt – als Zweifel an einer Institution, die beansprucht zu wissen, was gut für Menschen ist.
50 Jahre später hat sich der Diskurs verschoben. Statt Protest gegen Zwang und Hierarchie dominieren heute Selbstdiagnose und Selbstaufklärung. »Wenn man heute durch Buchhandlungen geht, findet man zahllose Ratgeber zu Depression, ADHS oder Autismus«, beobachtet Humanmediziner Vitecek. »Doch kaum ein Buch hinterfragt die Diagnose selbst. Der antipsychiatrische Gedanke ist aus der Öffentlichkeit verschwunden.«
An die Stelle der kollektiven Rebellion ist die individuelle Optimierung getreten. Statt Zwangsjacken gibt es Selbsttracking-Apps, statt Revolte Coaching-Programme. Die Gesellschaft scheint den Wahnsinn gezähmt zu haben – doch verschwunden ist er nicht. Vielleicht liegt gerade darin die Aufgabe der Gegenwart: eine Psychiatrie zu denken, die heilt, ohne zu beherrschen – und eine Gesellschaft, die Anderssein aushält, ohne es zu pathologisieren.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.






