- Wirtschaft und Umwelt
- Tarifpolitik
Beschäftigte im Öffentlichen Dienst: Ohne sie geht nichts
Verdi will sieben Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten der Länder

Sie unterrichten die Kinder, pflegen die Alten, reinigen Büros und bauen Straßen: Ohne die Beschäftigten im öffentlichen Dienst würde nichts funktionieren. Nun geht es um die Lebensbedingungen von vielen von ihnen, denn neue Verhandlungen für den Tarifvertrag der Länder (TV-L) stehen an. Dieser regelt die Arbeitsbedingungen der rund 1,2 Millionen Tarifbeschäftigten der Länder mit Ausnahme von Hessen. Die Gewerkschaft Verdi fordert, das Verhandlungsergebnis zudem wie üblich auf die 1,3 Millionen Beamt*innen zu übertragen.
Die Bundestarifkommission, die die Verhandlungen für die Arbeitnehmerseite führt, verkündete diesen Montag ihre Forderungen: sieben Prozent mehr Geld, mindestens aber 300 Euro im Monat zusätzlich. Eine solche Festgeldforderung kommt besonders den unteren Lohngruppen zugute. Verdi fordert zudem, dass Nachwuchskräfte monatlich 200 Euro mehr erhalten und bei erfolgreichem Abschluss unbefristet übernommen werden sollen. Die Zeitzuschläge, wie für Feiertage oder Nachtschichten, sollen um 20 Prozentpunkte steigen, die Vertragslaufzeit zwölf Monate betragen.
»Dass die Gehälter im öffentlichen Dienst nicht auseinanderdriften, ist schlicht eine Frage der Gerechtigkeit«, meint Frank Werneke, Verdi-Bundesvorsitzender. 2006 löste die Arbeitgeberseite die Tarifgemeinschaft auf, wodurch zwei getrennte Tarifverträge für den öffentlichen Dienst von einerseits Bund und Kommunen, andererseits den Ländern entstanden. Im Frühjahr hatte die Bundestarifkommission einem Vertrag für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten der ersten Gruppe zugestimmt. Dieser sieht eine Entgelterhöhung von drei Prozent rückwirkend ab April 2025 – mindestens aber 110 Euro pro Monat – und ab Mai 2026 um 2,8 Prozent vor. Ein Tarifvertrag für die Länder sollte im Minimum aufschließen. Laut Werneke gelte es, eine notwendige Angleichung auch für die Bedingungen in Ost und West zu erreichen.
Die angespannte Lage dürfte nur ein Vorspiel für die kommenden Verhandlungen sein.
Am 3. Dezember starten die Verhandlungen. Dann sitzt Verdi der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) gegenüber. In ihr sind die Finanzminister aller Bundesländer außer Hessen organisiert. TdL-Vorsitzender Andreas Dressel, Hamburgs SPD-Finanzsenator, deklarierte die Forderungen bereits vor Verhandlungsauftakt als »ritualisiert astronomisch«. Das Preisniveau, das laut Verdi im Sommer 2025 um 20 Prozent höher als im Jahr 2021 liegt, nannte Dressel hingegen nicht »astronomisch«. Auch zu Nahrungsmittelpreisen, die seit 2021 durchschnittlich um mehr als ein Drittel gestiegen sind, äußerte er sich nicht.
Laut Verdi habe sich zudem die Finanzlage der Bundesländer im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert, was einen größeren Handlungsspielraum für die Löhne der Beschäftigten zulasse. Im ersten Halbjahr 2025 lagen die Steuereinnahmen der Länder um mehr als acht Prozent höher als im Vorjahr. Hingegen befürchtet Verdi, dass die Länder die beschlossenen Steuersenkungen vor allem für Großunternehmen gegen die Gehälter im öffentlichen Dienst ausspielen könnten.
Volker Geyer, Bundesvorsitzender der DBB Beamtenbund und Tarifunion, verweist auf fehlendes Personal im öffentlichen Dienst. Dies äußere sich in »vernachlässigten Straßen, Pflegenotstand, Unterrichtsausfall« und sei der Grund dafür, dass laut Umfragen 73 Prozent der Bürger*innen den Staat für überfordert halten. Auch ein allgemein schwindendes Sicherheitsgefühl habe damit zu tun. Insbesondere da der öffentliche Dienst in Konkurrenz mit der privaten Wirtschaft stehe, müsse der Arbeitgeber Staat attraktiver werden. Auf das Gegenargument der Länder, es handele sich immerhin um sichere Arbeitsplätze, entgegnet er: »Ein sicherer Arbeitsplatz ist bei Aldi an der Kasse kein Zahlungsmittel.«
Nicht nur zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite, auch innerhalb der Gewerkschaft selbst war zuletzt eine Diskussion um die Forderungen entbrannt – schon vor ihrer Veröffentlichung selbst. Das Netzwerk für eine kämpferische und demokratische Verdi sowie das Netzwerk Kämpferischer Gewerkschafter*innen in der Bildungsgewerkschaft GEW hatten Anfang November in einer gemeinsamen Stellungnahme 600 Euro monatlich mehr gefordert. Nur sieben Prozent lägen hingegen unter der letzten Forderung für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen und würden nicht ausreichen, um die Lebenshaltungskosten zu decken. Zudem hätte der Abschluss Ende 2023 einen Reallohnverlust bedeutet, was die neuen Forderungen ausgleichen sollten. Moniert wird ferner, dass »Gelder in Panzer fließen, statt in die öffentliche Daseinsvorsorge«.
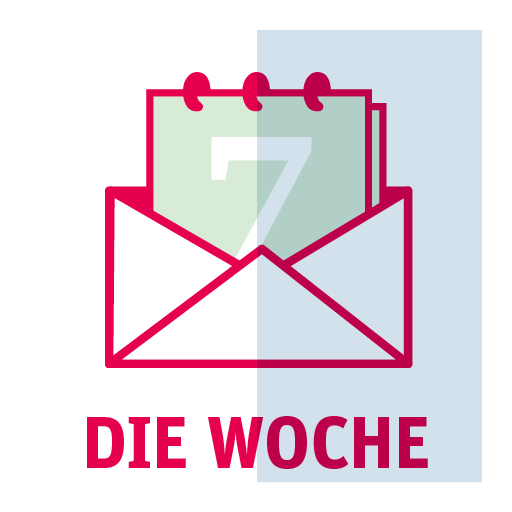
Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Zusätzlich kritisieren die zwei Netzwerke fehlende Demokratie bei der Forderungsfindung und Festlegung von Streiktaktiken. Es fand in Verdi zwar eine Mitgliederbefragung zur Forderung statt, diese hätte jedoch bereits den Rahmen von sieben Prozent vorgegeben und andere wichtige Fragen ausgeklammert. Kämpferische Kolleg*innen sollten nicht »passiv den Aufrufen der Gewerkschaftsführungen folgen«, sondern selbst Diskussionen führen und »aktiv Einfluss auf die Streiktaktik nehmen«, etwa durch Streikversammlungen. Dies könne Strukturen für kommende Konflikte stärken.
Die Verdi-Betriebsgruppe der Freien Universität Berlin hatte sich mit einer Stellungnahme diesem Papier angeschlossen. Doch die Fachbereichsleitung des Verdi-Bezirks Berlin-Brandenburg löschte den Beitrag von der Betriebsgruppenseite. Tags darauf schaltete sie deren Website selbst ab. Die Gewerkschaft scheint damit die Kritik der Basisaktiven indirekt zu bestätigen. Gegenüber dem »nd« meint Claudius Naumann vom Betriebsgruppenvorstand, der Verdi-Bundesvorstand und die Bundestarifkommission wollten verhindern, »dass der Rahmen des üblichen Sozialpartnerschaftsrituals gesprengt wird, in welchem für die Mitglieder nur eine Statistenrolle mit Trillerpfeife vorgesehen ist«. Ein »entschiedener Kampf für die Interessen der Beschäftigten« würde »unweigerlich mit der Politik für die Herstellung der ›Kriegstüchtigkeit‹ und ihrer Rüstungsbillion kollidieren«.
Die Debatte kristallisiert nicht nur Interessenskonflikte zwischen den Beteiligten heraus. Sie spiegelt auch den angespannten wirtschaftlichen und politischen Kontext wider. Die Lage dürfte sich nicht beruhigen – sondern ein Vorspiel für die kommenden Verhandlungen sein.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.






