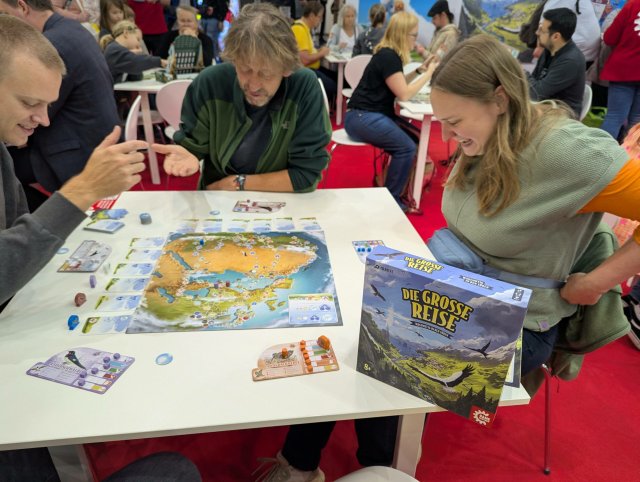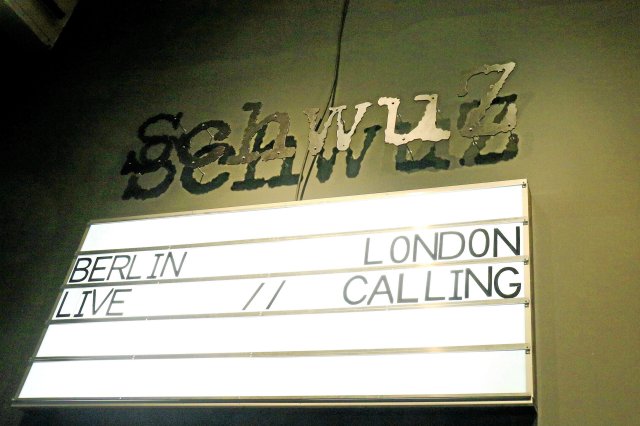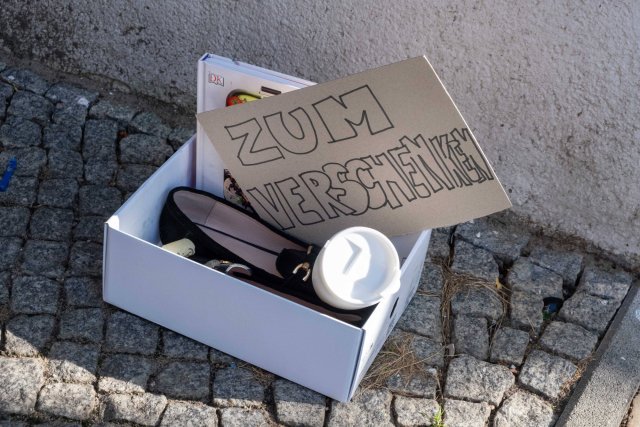- Kommentare
- 60 Jahre Israel
Wenn Ihr wollt, ist es kein Märchen ...
Die Vision des Theodor Herzl und die Geburt der zionistischen Idee
Kurz nach Vollendung des 44. Lebensjahres starb Theodor Herzl am 3. Juli 1904 in einem Sanatorium in Edlach am Semmering. Schon seit Längerem hatten den Begründer des politischen Zionismus Todesahnungen gequält. Das Herzleiden, an dem er seit Jahren laborierte, hatte sich zusehends verschlechtert. Aber anstatt sich an die Ratschläge der Ärzte zu halten, die ihm Kuraufenthalte verschrieben und ihm anrieten, sich arbeitsmäßig nicht allzu viel zu- zumuten, stürzte sich Herzl verstärkt in die Arbeit und bemühte sich weiter um die Realisierung seines Judenstaatstraumes, der 1948 Wirklichkeit werden sollte.
Geradezu besessen von der Idee, dass es ohne ihn nicht ginge und die Grundlagen für den jüdischen Staat noch zu seinen Lebzeiten gelegt werden müssten, nahm Herzl nicht allzu sehr auf seinen angegriffenen Gesundheitszustand Rücksicht. Tag und Nacht saß er am Schreibtisch, schrieb Briefe und verfasste Denkschriften. Oder er war unterwegs, um Gesinnungsgenossen oder Politiker zu treffen, von denen er sich erhoffte, sie könnten ihn bei der Umsetzung seiner Pläne unterstützen.
In Basel wurde der Judenstaat gegründet
Wie sehr er in seinen letzten Lebensmonaten davon überzeugt war, dass er für die zionistische Bewegung unentbehrlich sei, zeigt eine Passage in einem der letzten Briefe. Dieser, an David Wolffsohn gerichtet, den lieben Daade, wie Herzl jenen nannte, spiegelt die Verantwortung, die er für den Fortgang der Arbeit empfinden zu müssen glaubte. Die Briefpassage enthält die bis heute als rätselhaft empfundene Präsenz-Formulierung: »Machet keine Dummheiten, während ich tot bin. Herzlich grüßt ein zu Schanden gearbeiteter ...« (6. Mai 1904).
Als Herzl dann tatsächlich starb, kam das für die meisten der Zeitgenossen überraschend. Auf manche wirkte sein Ableben wie ein Schock. Es gab kaum jemanden, der bezweifelte, dass das moderne Judentum und der Zionismus ei-nen herben Verlust erlitten hätten. Die zahlreichen Nachrufe in den jüdischen und nichtjüdischen Blättern wetteiferten geradezu miteinander, seine Verdienste herauszustellen. Kaum ein Blatt unterließ es, ihn als einen der großen Männer des Jahrhunderts zu bezeichnen. Allerdings wurde nicht nur Bedauern geäußert, es gab auch skeptische Stimmen, die sein Wirken im Rückblick weniger positiv bewerteten und seinen Tod sogar als eine Art Befreiung empfanden.
Nach Herzls Ableben brachen in der zionistischen Bewegung die Streitereien über Strategie und Taktik zukünftiger Politik offen aus. Die Lager standen sich unversöhnlicher denn je gegenüber. Welches war der richtige Weg? Sollte weiterhin das Ziel praktischer Arbeit in Palästina verfolgt werden? Also verstärkte Siedlungspolitik? Oder sollte man, wie es Herzls Vorstellungen entsprach, in erster Linie eine politisch-territoriale Lösung verfolgen – was besagte, ein Territorium zu sichern, auf dem der Judenstaat errichtet werden könnte? Wie Herzl sich in diesen Auseinandersetzungen verhalten hätte, darüber kann nur spekuliert werden. Geht man von der Situation zur Zeit seines Todes aus, kann man nur den Schluss ziehen, dass ihm vermutlich nicht mehr die Wirkung beschieden gewesen wäre, wie das unmittelbar nach dem Zionistenkongress 1897 in Basel der Fall war. Damals hatte er in sein Tagebuch notiert: »Fasse ich den Baseler Kongress in ein Wort zusammen – das ich mich hüten werde, öffentlich auszusprechen –, so ist es dieses: In Basel habe ich den Judenstaat gegründet. Wenn ich das laut sagte, würde mir ein universelles Gelächter antworten. Vielleicht in 5 Jahren, jedenfalls in 50 wird es jeder einsehen ...«
Im historischen Rückblick lassen sich vielfache Beziehungen zwischen Herzls Wirken, der weiteren Entwicklung des Zionismus und der Politik des heutigen Staates Israel aufzeigen. Aus der Vielfalt der Themen und Probleme, die in diesen Zusammenhang gehören, sei hier nur das Verhältnis Herzls und des frühen Zionismus zu den Arabern genannt. Dieses rückt in den letzten Jahren zunehmend in das Blickfeld des Interesses, wird aber nicht so diskutiert, wie es diskutiert werden müsste, um daraus entsprechende Erkenntnisse für unsere Gegenwart zu ziehen.
Fest steht, dass Herzl und die meisten führenden Zionisten der Frühzeit von der illusionären Vorstellung bestimmt waren, in einer Art politischem Vakuum zu agieren. Bezeichnend ist ein Ausspruch, den Max Nordau angeblich gegenüber Herzl 1897 getan haben soll: »In Palästina gibt es ja Araber! Das wusste ich nicht! Wir begehen also ein Unrecht.« Dieser Ausspruch mag erfunden sein, doch kennzeichnet er im Kern die Einstellung der frühen Zionisten, die Palästina für ein leeres Land hielten, das nur darauf wartete, von jüdischen Siedlern kolonisiert und kultiviert zu werden. Die Möglichkeit einer einheimischen Opposition wurde völlig übersehen. Ein geflügeltes, vermutlich von dem Schriftsteller Israel Zangwill stammendes Wort jener Jahre hieß: »Ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land.«
In den Schriften, Reden und Briefen Herzls ist nur wenig über die palästinensischen Araber zu finden. Und wenn einmal doch, dann nicht hinsichtlich ihrer legitimen historischen Ansprüche und ihres Lebensrechts in Palästina. Nicht zu Unrecht hat deshalb Nahum Goldmann einmal bemerkt, es sei »einer der großen historischen Denkfehler des Zionismus« gewesen, »dass er den arabischen Aspekt bei der Gründung des jüdischen Heimatlandes nicht ernsthaft genug zur Kenntnis genommen« habe. Der Historiker, der sich heute mit den Ursachen und Gründen des israelisch-palästinensischen Konflikts beschäftigt, kommt deshalb nicht umhin, Fragen zu stellen – schmerzhafte Fragen. Es würde allerdings die Realität verzeichnen, würde man den Mangel an Voraussicht nur der zionistischen Ideologie und Programmatik allein anlasten. Keiner der damals Beteiligten hat die künftige Entwicklung voraussehen können. Niemand konnte ahnen, dass die Nichtkenntnisnahme beziehungsweise das Nichternstnehmen der Ansprüche der palästinensischen Araber sich in der Zukunft zu einem kaum noch lösbaren Problemknäuel auswachsen würden. Herzl und seine Freunde waren wie die meisten ihrer Zeitgenossen vom mitteleuropäischen Zeitgeist jener Jahre geprägt, der außereuropäische Kulturen nicht als gleichwertig ansah.
Sicherlich ist manches gegen die Politik und das Wirken Herzls vom heutigen Standpunkt aus einzuwenden. Schon Martin Buber hat diesen nicht für einen großen politischen Theoretiker gehalten, aber im Rückblick gemeint, seine Bedeutung habe insbesondere in der Tatsache gelegen, dass er der erste Jude war, »der im Exil jüdische Politik gemacht hat«. Entscheidend erschien Buber und anderen der Niederschlag, den Herzls visionäre Überlegungen gefunden haben. Er sei, so meinte man, ein »Staatsmann ohne Staat« gewesen. Das ist sicherlich zutreffend. Aus dem historischen Rückblick lässt sich konstatieren, dass Herzl es mit seiner charismatischen Überzeugungskraft verstanden hat, die Massen zu sammeln und für die Ziele des Zionismus zu begeistern.
Eine Revolution ohne Beispiel
Herzls Propagierung der Idee eines jüdischen Nationalstaates hat einer »Revolution« den Weg gebahnt, die in der Geschichte der Menschheit ohne Beispiel ist. Die Erkenntnis, dass die räumliche Sammlung, die Befreiung aus dem materiellen und seelischen Druck der Umwelt die einzige Lösung für die Juden als Gesamtheit bedeute, führte zu einer Stärkung des jüdischen Bewusstseins bei einer nicht geringen Anzahl von Juden, die lernten, wieder aufrecht zu gehen und den Nichtjuden mit erhobenem Haupt und in gleicher Augenhöhe gegenüberzustehen. Die zionistische Idee ist deshalb mehr als nur eine Vision. Sie ist auch, und das gilt es heute besonders zu betonen, so etwas wie das Bemühen und der Versuch des modernen Juden, sich seiner selbst bewusst zu werden, was heißt, sich als Jude in einer feindlich gesinnten Umgebung existenziell zu behaupten.
So mancher Jude wurde sich überhaupt erst einmal wieder der Tatsache bewusst – wie Herzl im Übrigen selbst –, dass er Jude war. Andere, besonders im Ostjudentum, fingen an, eine reale Zielvorstellung vor Augen zu haben, der sich ihr ungebrochen vorhandenes nationaljüdisches Volksbewusstsein zuwenden konnte. Noch zu Herzls Lebzeiten nahmen einige dieser Menschen, begeistert von den Visionen des Zionismus, ihren Weg nach Palästina, begannen dort Sümpfe trockenzulegen und Wüsten zu bewässern – begannen, wie es in der heroischen Sprache der Siedler jener Jahre hieß, »das Land mit ihrer Hände Arbeit zu gewinnen.«
Herzls politisch-diplomatische Aktivitäten sind vielfach zu Recht kritisiert worden. Man hat oft gefragt, ob er mit der von ihm betriebenen Charter-Politik nicht den falschen Weg gewiesen hat. Viele Faktoren in den damaligen politischen Konstellationen sind von Herzl zweifellos falsch eingeschätzt worden: So der Einfluss des Großherzogs von Baden auf die Politik der deutschen Reichsregierung, so die Macht und die Persönlichkeit Wilhelm II., so die Berechenbarkeit der türkischen Bedürfnisse und so schließlich auch die Interessenlagen der russischen Staatsmänner. Vieles kam schließlich anders und manches war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Das Ostafrika-Projekt (Herzl wollte zeitweilig dort den »Judenstaat« gründen) war ein politischer und taktischer Fehler, denn dieses Vorhaben erwies sich sehr bald als nicht realisierbar und brachte Verwirrung und Spaltung in die zionistische Bewegung. Herzl machte die Erfahrung, dass die jüdischen Massen insbesondere in Osteuropa nicht für ein Territorium irgendwo auf der Welt, sondern nur für Palästina zu gewinnen sein würden. Die Gebetsformel »Nächstes Jahr in Jerusalem« war ein Versprechen, das insbesondere für die Juden in Osteuropa einen geradezu verpflichtenden Charakter hatte.
Wenn Herzl wegen des Scheiterns der Verhandlungen mit dem Deutschen Reich, der Türkei und Ägypten zeitweilig ein anderes Gebiet als Palästina in Erwägung gezogen hat, so zeigt das, wie wenig er dem traditionellen Judentum verbunden war. Er blieb Zeit seines Lebens der assimilierte österreichische Jude deutscher Kultur, der sich aus persönlichem Stolz und aus sozialem Mitgefühl zum verachteten Judentum bekannte. Vielleicht war das auch der Grund, warum er zeitweilig mit dem Gedanken spielte, die Juden in Ostafrika anzusiedeln. Herzl wusste zwar, dass mit diesem Projekt, die »Judenfrage« nicht gelöst werden könnte, doch meinte er, es sei zwingend notwendig, schnellstens etwas gegen die Judenfeindschaft und deren Auswüchse zu tun – auch wenn, wie er vermutlich geahnt hat, nicht viel bei diesen Bemühungen herauskommen würde.
Ausschlaggebend für den Entschluss zu schnellem Handeln waren wohl die Nachrichten vom Pogrom in Kischinew im April 1903. Es sei nur eine einzige Antwort möglich, schrieb Herzl damals an Freunde, die planvolle Massenauswanderung in ein rechtlich geschütztes Territorium, denn Kischinew sei nicht zu Ende. Die Erkenntnis von der Recht- und Schutzlosigkeit der Juden hatte ihn im Innersten getroffen. Er behielt mit dieser Feststellung, dass »Kischinew nicht zu Ende sei« zumindest in einem ganz vorläufigen Sinne Recht, die Pogrome in Russland hörten nicht auf, in größerem Umfang wiederholten sie sich nach der Revolution 1905 und im Bürgerkrieg der weißen und roten Armeen. Was uns heute nachdenklich stimmt, ist jedoch etwas anderes. Herzl hatte damals um jeden Preis die nach Millionen zählende Bevölkerung der russisch-polnischen Ansiedlungsgebiete retten wollen, in denen sich 40 Jahre später der organisierte Massenmord abspielte. Das ist ihm nicht gelungen. Tragischerweise.
Wenn Herzl sich in seinen letzten Monaten dem Ziel Palästina schließlich als einzig möglichem anschloss, so hinterlässt dies den Eindruck, als ob propagandistische Rücksichten die ausschlaggebende Rolle gespielt hätten. Die Massen mussten schließlich zur Wanderung bewegt werden. Herzl persönlich war nicht unbedingt für Palästina, sah aber ein, dass die Juden, die zur Wanderung überhaupt bereit waren, nur für Eretz Israel als Ziel der Wanderung zu überreden waren. Dem fügte er sich. Darin wurde er zudem noch durch die Eindrücke bestärkt, die er aus seiner Palästina-Reise 1898 gewonnen hatte. Es war schließlich nur noch Palästina, das ihm als »Land der Zukunft« erschien.
Herzl hatte als seine vorläufige Ruhestätte den Döblinger Friedhof am Fuße des Wiener Waldes bestimmt – so lange, bis das jüdische Volk in die Lage versetzt sein würde, seine sterblichen Reste nach Palästina zu überführen. Dort hatte er für sich seine letzte Ruhestätte vorgesehen. Als Herzls Prophezeiung, der Judenstaat werde in weniger als 50 Jahren Wirklichkeit, in Erfüllung ging, war eine der ersten Handlungen Israels, seine Gebeine von Wien nach Jerusalem zu überführen und 1949 auf dem Mount Herzl in einer feierlichen Zeremonie zu bestatten. Der Grabstein, der ihm dort unter Pinien, Zedern und Zypressen gesetzt wurde, ist ein schlichter, schwarzer Marmorblock. Auf ihm steht in hebräischen Lettern der Name »Herzl« eingemeißelt. Vielleicht hätte man noch Herzls berühmtes Motto hinzusetzen sollen »Im tirzu ain zu agada« – »Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen.«
Träume müssen nicht Träume bleiben
Der Besucher, der heute seine Schritte über den Herzl-Berg lenkt, ist sich bewusst, dass die letzte Ruhestätte des Begründers der zionistischen Bewegung mehr ist als nur eine x-beliebige Grabstätte. Er spürt, dass er an einem Ort steht, der für Juden in aller Welt eine zutiefst symbolische Bedeutung besitzt. Und er erkennt auch, wenn er seinen Blick vom Herzl-Berg über Jerusalem und die Berge Judäas schweifen lässt, dass Träume nicht unbedingt nur Träume bleiben müssen. Träume können auch Wirklichkeit werden. Gründung und Existenz des Staates Israel sind der Beweis dafür.
Professor Julius H. Schoeps wurde 1942 in der Emigration im schwedischen Djursholm geboren. Der Direktor des Moses Mendelssohn Zentrum in Potsdam ist unter anderem der Autor einer Herzl-Monographie und Herausgeber von dessen Briefen und Tagebüchern.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.