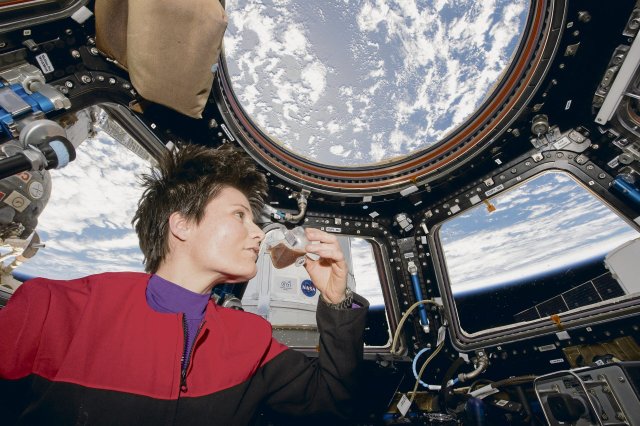Fabrik in der Zelle
Chemiepreis geht an drei Molekularbiologen
Auch unter den Laureaten in der Sparte Chemie ist in diesem Jahr eine Frau: Ada E. Yonath (70) vom Weizmann-Institut im israelischen Rehovot. Sie teilt sich den Preis mit dem US-Amerikaner Thomas A. Steitz (69) und dessen Landsmann Venkatraman Ramakrishnan (57), der in Indien geboren wurde und derzeit in England arbeitet.
Die drei Forscher haben herausgefunden, wie der genetische Code der DNA in Proteine (Eiweiße) übersetzt wird. Denn so wichtig Gene für das Leben auch sind, ohne das Vorhandensein von Proteinen könnte kein Organismus irgendeine Tätigkeit ausführen. Proteine bauen die Muskeln auf. Sie spalten die Nahrung, transportieren den lebensnotwendigen Sauerstoff und wehren als Antikörper Krankheitserreger ab. Grundsätzlich bestehen alle Proteine aus Aminosäuren, die entsprechend der jeweiligen Erbinformation im Körper Stück für Stück zusammengefügt werden müssen. Das geschieht in den zahlreichen Proteinfabriken der Zelle, den sogenannten Ribosomen, die selbst aus einer Vielzahl von Eiweißen und Ribonukleinsäuren bestehen.
Den drei Preisträgern sei etwas gelungen, begründete das Stockholmer Nobel-Komitee seine Entscheidung, was noch vor 40 Jahren nahezu undenkbar schien: »Sie haben die dreidimensionale Struktur der Ribosomen enthüllt.« Einen ersten Forschritt auf diesem Weg erzielte Yonath 1980, als sie die Riesenmoleküle in eine perfekte Kristallform überführte und anschließend mit Röngtenstrahlen durchleuchtete. Diese frühen Darstellungen waren jedoch recht ungenau. Und so vergingen weitere 20 Jahre, bis Yonath, Steitz und Ramakrishnan den Aufbau von Ribosomen bis hin zur Lage einzelner Atome aufklären konnten.
Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sind von großer Bedeutung für die Medizin. Denn zahlreiche Antibiotika machen Bakterien unschädlich, indem sie sich an deren Ribosomen heften. In der Pharmaforschung geht man daher unmittelbar von der Struktur der Ribosomen aus, um neue Antibiotika zu synthetisieren. Diese Medikamente könnten für viele Menschen künftig lebensrettend sein, da immer mehr Bakterien gegen die vorhandenen Antibiotika Resistenzen entwickeln.
Obgleich deutsche Forscher in diesem Jahr in Stockholm leer ausgingen, haben zumindest deutsche Forschungseinrichtungen einen gewissen Anteil an den prämierten Entdeckungen. So arbeitete Yonath mehrere Jahre am Max-Planck-Institut für Molekulare Genetik in Berlin, während Steitz einige Zeit am Göttinger Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie tätig war.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.