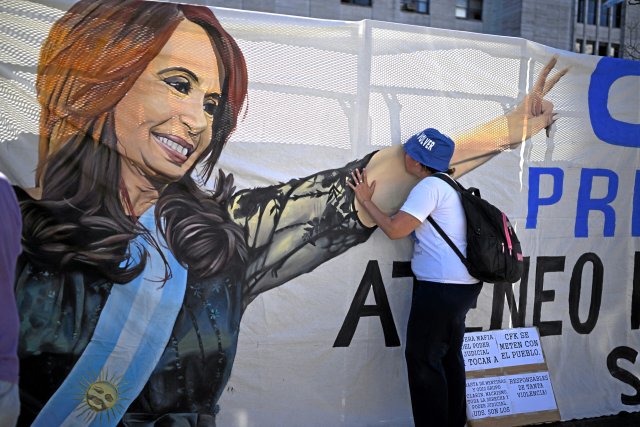Russland
»Dich, wie die erste Liebe, wird
Russlands Herz niemals vergessen«,
beschrieb der Dichter Fjodor
Tjutschew einst das »Phänomen«
Alexander Puschkin
Moskau, 6. Juni 2001, am Abend des 203. Puschkin-Geburtstags: Eine Menschenmenge umringt das Denkmal auf dem Puschkin-Platz. Eine blecherne Stimme erklingt, Passagen aus dem Gedicht »An ***« (1825):
-----------------------------------------------------------------
Ein Augenblick ist mein gewesen
Du standst vor mir mit einem Mal
ein rasch entfliegend Wunderwesen
der reinen Schönheit Ideal.
Im schmerzlich hoffnungsvollen Sehnen
Im ew'gen Lärm der Menschenschar...
-----------------------------------------------------------------
Plötzlich Stille. Ein junger Mann unter dem Denkmal bewegt die Lippen, doch sein Mikrofon scheint ausgefallen zu sein. Das wird im Laufe des Abends noch mehrmals passieren, was aber nicht sonderlich stört, da die Texte offensichtlich bekannt sind, viele murmeln sie leise mit:
-----------------------------------------------------------------
Die Jahre gingen, Sturmestosen
zerstreuten frühe Träume weit
und ich vergaß der Stimme Kosen
der Himmelszüge Lieblichkeit.
-----------------------------------------------------------------
Gerührt umarmen Pärchen einander. Der junge Mann spricht frei, mit tiefer, bebender Stimme. Lang anhaltender Beifall.
Dies ist keine der offiziellen Veranstaltungen, wie sie zum Puschkin-Geburtstag vielerorts in Moskau stattfinden. Es ist vielmehr ein spontanes Treffen von Puschkin-Verehrern.
Zu seiner Zeit besaß der Dichter weniger Freunde, dafür um so mehr Feinde, vor allem infolge seiner scharfzüngigen Epigramme über Persönlichkeiten seiner Zeit. Einem augenscheinlich »wenig spannenden« Zeitgenossen hinterließ er die Zeilen: »Ach bitte, Fjodor, komm nicht mehr zu mir rauf, erst schlaf ich durch dich ein - und dann weckst du mich auf.«
Puschkin, wie er heute auf seinem Denkmalssockel steht, hatte dunkle lange Locken, einen Backenbart und einen dunklen Teint. Der Stammvater der modernen russischen Literatursprache, der den Grundstein für die weltliterarisch bedeutsame Entwicklung der kritisch-realistischen Literatur in Russland legte, besaß einen »fernverwurzelten« Stammbaum. Sein Urgroßvater stammte aus dem heutigen Äthiopien. Peter I. kaufte ihn für eine Unze Tabak bei Sklavenhändlern, holte ihn an seinen Hof, kümmerte sich um seine Ausbildung; später diente der Urgroßvater auf den Schiffen Peters I. »The Great Black Russian« wird Puschkin daher in Amerika genannt.
Zwei Mädchen, Anja und Nina, elf Jahre alt, treten vor und tragen gemeinsam, sich an den Händen haltend, das Gedicht »Winterabend« (1825) vor. Die hellen Kinderstimmen erhalten viel Aufmerksamkeit, sprudelnd beginnen sie, bis sie sich in den Rhythmus hineinfinden. Überschäumender Applaus, der Moderator umarmt die beiden.
Das Mikrofon wechselt von einer Hand zur nächsten. Jeder stellt sich kurz vor. Junge und alte Stimmen rezitieren; daraus lassen sich Schicksale erahnen. Die einen spiegeln Optimismus und eine gewisse Unbeschwertheit wider, wie in der kühnen, frechen Lyrik des Autors, vor allem in seinen frühen Werken. Ein Beispiel dafür: »An eine tabakschnupfende Schöne«, von einem Studenten rezitiert.
-----------------------------------------------------------------
Ja, schau ich recht?
Anstatt des Liebesgottes Rosen
Statt hoher Tulpendamen Kosen
Statt Schneeglöckchen und des
Jasminstrauchs Blütenheer
Die du geküsst in alten Tagen
Und unlängst täglich noch ertragen
An deines weißen Busens Wehr ...
Ein trockner Moderknaster
fing dein Herz nun ein
Schmunzelnd lauscht die Menge dem Studenten.
Wenn doch ein Wunder mich beglückt'
Und wär ich Knaster!
Ach, wie würde ich schmusen
Die zarte Hand
die mich dann zärtlich hält
Da läg ich weich;
ach, wer so glücklich fällt!
-----------------------------------------------------------------
Andere Stimmen sind von Ernst und Melancholie geprägt. Sie zeugen von der Unsicherheit vieler Menschen im heutigen russischen Alltag. Schwermut befiel Puschkin, als der Aufstand der russischen Adelsrevolutionäre gegen den Zaren, zu denen auch seine Freunde gehörten, niedergeschlagen wurde. Für die geistige Nähe zu ihnen hatte er Verbannung, permanente Überwachung und Zensur zu ertragen.
Sascha P. stellt sich als Mathematiker vor, 1990 promoviert, zeitweise lehrte er an der Fachhochschule, nun ist er seit langem arbeitslos. Er deklamiert Zeilen aus dem Gedicht »An Tschaadajew« (1818), das zum Symbol für Puschkins Freiheitsliebe, sein humanistisches Bestreben gegen geistige Enge, Leibeigenschaft und rücksichtslose Alleinherrschaft des Zaren wurde und gleichzeitig die tiefe Liebe zu seinem Land ausdrückte:
-----------------------------------------------------------------
Gerichtet ist all unser Sinnen
auf unser Freiheit erstes Glück.
-----------------------------------------------------------------
Sascha P. steht da im abgetragenen Anzug, mit abgehärmtem Gesicht und schreit es sich förmlich aus der Seele:
-----------------------------------------------------------------
So lang noch brennt der Freiheit Glut
so lang wir noch der Ehre leben,
weih'n wir der Heimat unsern Mut
nur ihr, o Freund, gilt unser Streben!
Und glaube mir, es ist kein Trug
wir seh'n den Stern des Glücks
noch schimmern
wenn Russland sagt: es ist genug!
Und auf der Despotie in Trümmern
erscheint einst unser Namenszug!
-----------------------------------------------------------------
Die Worte wühlen Sascha auf, ein Kloß scheint ihm im Hals stecken zu bleiben. Bei den Zuhörern: deutliche Anteilnahme. Man bittet ihn, sich zu beruhigen.
»Bitte, der Nächste, kommen Sie doch vor, ich kann Ihnen ansehen, dass sie nicht nur einen Text von Puschkin aufsagen können.« Und tatsächlich, die Frau, die nach einigem Zögern der Einladung folgt, als wäre es vorher abgesprochen, trägt mit beeindruckender Betonung einen Auszug aus dem Brief Tatjanas an Onegin aus dem Roman-Poem »Eugen Onegin« vor:
-----------------------------------------------------------------
Warum nur haben Sie auf's Land
in unser Dorf den Weg gefunden?
Ich hätte niemals Sie gekannt
nie diese bitt're Qual empfunden.
-----------------------------------------------------------------
Plötzlich jedoch bleibt sie stecken. Und - unglaublich - fast einstimmig hilft ihr die Menge weiter:
-----------------------------------------------------------------
Ein and'rer! -
Nein, ich könnte nimmer
mein Leben einem and'ren weih'n!
Beschlossen hat es Gott: für immer
bin ich durch seinen Willen Dein!
-----------------------------------------------------------------
Puschkin lebt! Auch bei jungen Russen ist er nicht »out«, nicht etwa mit abgelagerten Schulsedimenten entsorgt. Seine Texte und sein Denkmal sind nicht »totenstarr«, sie sind Herausforderung und Inspiration vieler sehr bekannter junger Poeten und Barden. Sein Stil oder dessen Ableger »grooven« - wie es modisch heißt - auch heute unverkennbar.
Der Moderator dieses Treffens, Oleg Drushbinski, ist Vorsitzender des Puschkin-Liebhaber-Kreises. Er war früher Fernsehsprecher und unterrichtet heute Rhetorik. Mit zwei Freunden hatte er sich vor sieben Jahren erstmals spontan am 6. Juni an diesem Ort getroffen und Gedichte rezitiert. Bald blieben nicht nur einige Interessenten stehen, bald wurde dieser Platz bekannt für die jährlichen Treffen der Puschkin-Fans. Man schreibt keine Einladungen, die Tradition hat sich herumgesprochen. Mal kommen mehr, mal weniger, aber insgesamt wächst der Kreis der Fans. Einige sind sogar aus anderen Städten angereist: Einer der Vortragenden kommt aus dem rund 1000 Kilometer entfernten Orlow, fünf Gedichte hat er mitgebracht.
Den von Puschkin verehrten Byron deklamiert ein stattlicher Mann, dem Outfit nach einer der wohlhabenden »Neuen Russen«, frei und ganz im melodischen Alt-Englisch des Lord Byron. Der zweite Moderator dieses spontanen Treffens ist der Dichter Surnin, ehemals Leiter eines der Puschkin-Häuser. In seinen Gedichten, inspiriert von Puschkin, prangert er Zerfall und Verarmung der einst großen Nation an, geißelt Krieg und Terror zwischen Russen und ihren Brudervölkern. »Genau, genau«, viele murmeln Beifall.
Manchem treten Tränen in die Augen. »Wie soll man eine neue Generation ausbilden, geschweige denn selbst überleben, wenn mein Monatseinkommen als Dozentin heute 700 Rubel (ca. 50 Mark) beträgt?« fragt eine Frau aufgebracht. »Ich als Lehrerin erhalte heute 1200 Rubel«, ruft eine andere wütend, das sind 100 Mark. Kein falsches Pathos klingt aus den Worten der Rezitierenden. Auch kein Zynismus, wie man ihn heutzutage bei großen Teile der jungen westlichen Generation antrifft: Diese Welt sei nun einmal miserabel und nicht zu verbessern.
Die Luft knistert buchstäblich vor Intensität und puschkinscher Metaphorik. Seine Wort- und Formästhetik scheint sich immer wieder dem Nerv der Zeit anzupassen. Seine themen- und stimmungsreiche Lyrik und Prosa wechselt von elegisch, leidenschaftlich in humorvoll und scharf-sarkastisch bis zu wutentbrannt aufbegehrend oder unendlich zart-explosiv.
Nicht zuletzt weist Alexander Puschkin mit seiner Persönlichkeit und seinem tragischen Schicksal über die Politisierung des Moments hinaus. Über dem Eingang zur Metro, neben dem Denkmal, war bis vor kurzem auf einer großen Tafel ein Puschkin-Zitat in großen Lettern zu lesen. Es wird heute von einer unübersehbaren Werbefläche mit einer Autoreklame verdeckt. Auch hier die Vorboten der modernen Stadtästhetik, die neuen Ikonen des globalisierten Zeitalters: Die Poesie der Werbeflächen mit ihren neuen Idealen, die nichts als Konsum versprechen?
Jugendliche mit Ghettoblastern ziehen vorbei. »Nein«, widerspricht Drushbinski: »Puschkin wird immer unzertrennlich von der russischen Seele sein, ob in der Not oder im Überfluss. Er lebt in unseren Herzen.«