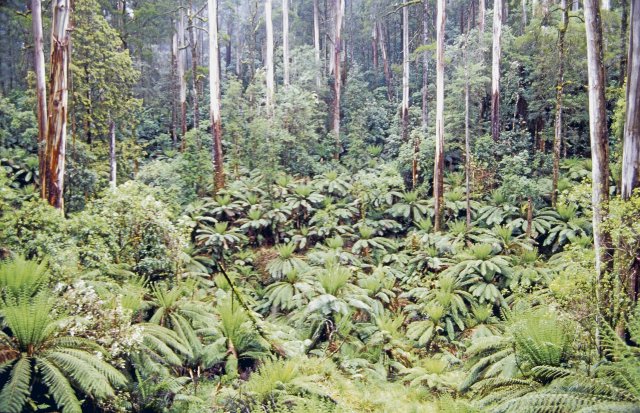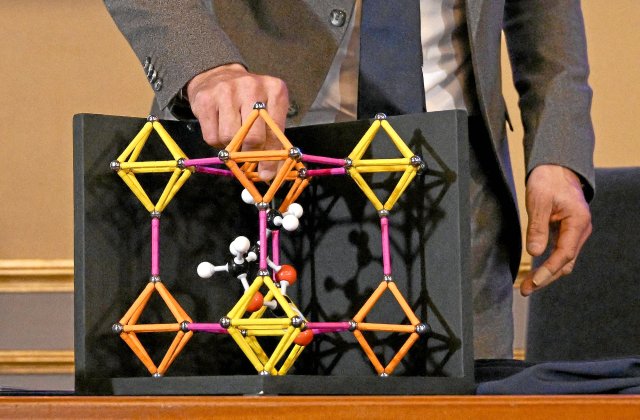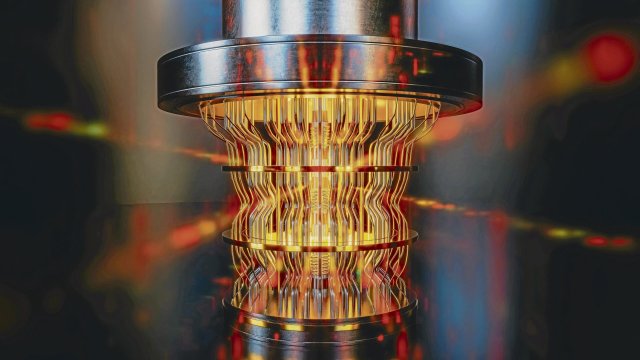- Wissen
- Arabische Welt
Entdecker unterm Halbmond
Mit seiner Tour durch weite Teile Asiens, Nord- und Ostafrikas stellte der marokkanische Rechtsgelehrte Ibn Battuta selbst Marco Polo in den Schatten
Fahrten bis nach China und Südafrika
Als der Islam von der Arabischen Halbinsel aus seinen Siegeszug antrat, drangen mit ihm die Araber in Regionen vor, die zuvor bereits diverse Höhen und Tiefen zivilisatorischer Entwicklung durchlebt und in maritimen Belangen viel an Wissen und Können vorzuweisen hatten. Von 639 bis 642 bemächtigten sich die Araber zweier Reiche - Ägypten und Persien -, die schon in der Antike auf See, sei es nun beim Handel oder beim Erkunden fremder Gestade, recht aktiv gewesen waren. Bereits um 115 v.u.Z.. soll es die erste direkte Segelfahrt von Ägypten nach Indien gegeben haben.
Erkundungen zu Lande und zur See
Beim weiteren Vordringen im Mittelmeerraum auf See bedienten sich die Araber aber meist der Hilfe »abtrünniger« byzantinischer Experten. So konnten sie 649 Zypern erobern, 655 eine byzantinische Flotte vor der kleinasiatischen Küste vernichtend schlagen, 652 und 667 Vorstöße nach Sizilien unternehmen und 672 sogar Konstantinopel erstmals belagern. Der islamische Einfluss reichte bald von Nordafrika bis zu den Grenzen Indiens und nach Innerasien hinein. Muslimische Kaufleute knüpften im Gefolge Handelsbeziehungen, die sich vom Inneren Schwarzafrikas bis nach Südostasien und China erstreckten und im 10. Jahrhundert selbst das Reich der Chazaren an der Wolga einbanden. Alexandria, Basra (gegründet 635) und Bagdad (gegründet 762) wurden zu Austauschzentren all der begehrten Waren, für die es lohnte, die Risiken weiter Reisen zu Wasser oder zu Lande einzugehen und damit verbundene Strapazen zu ertragen.
Obwohl muslimische Seefahrer in dieser Zeit eine rege Betriebsamkeit bis nach Südafrika und in chinesische Gewässer hinein entfalteten und keineswegs nur dicht an den Küsten entlang zu segeln vermochten, hielten sich die Seemachtambitionen der arabischen Herrscher doch eher in Grenzen. Zum einen sicher, weil man - abgesehen von Piratenattacken - gen Osten gewandt kaum eine echte Bedrohung von See her wahrnahm. Zum anderen verfügte man dort, wo eine solche Bedrohung existierte, d.h. im Mittelmeer vor allem durch Byzanz, entlang der Küsten über zahlreiche Befestigungen, um Attacken von See her zu trotzen, und konnte zudem auf Landrouten ausweichen, auf denen schon seit der Antike große und kleine Karawanen von »Wüstenschiffen« verkehrten. Altbekannte Handelswege wie die Weihrauchstraße und die Seidenstraße waren ohnehin über weite Strecken fest in arabischer Hand und dank der Tragkraft und Ausdauer des Kamels als solche überhaupt nutzbar. Fast alle Waren, angefangen von Gewürzen, edlen Metallen und kostbaren Stoffen bis hin zu Sklaven, ließen sich ebenso über Land mit kurzen Schiffstransporten auf Flüssen oder entlang der Küste befördern, was allerdings auch nicht zuletzt durch den üppig wuchernden Zwischenhandel die Preise in die Höhe trieb.
Diese »Sicherheit« minderte den Bedarf an Erkundungen zu Land und auf See jedoch nicht im Geringsten. Im Gegenteil, selbst in ihren Glanzzeiten war die arabisch-islamische Herrschaft im Inneren nicht vor Krisen und kriegerischen Auseinandersetzungen gefeit. Außerdem traten an den Grenzen zunehmend neue Akteure in Erscheinung, die es nicht zu unterschätzen galt; als potenzielle Handelspartner ebenso wie als künftige militärische Gegner. Letzte große Seemachtambitionen eines islamischen Großreichs, und zwar das der Osmanen, die ab dem 14. Jahrhundert neben Byzanz auch den Großteil der arabischen Welt ihrer Herrschaft unterwarfen, zerbarsten schließlich im Oktober 1571 bei Lepanto, wo die Flotte des Sultans im Ringen mit der Flotte der Heiligen Liga unter Don Juan d'Austria unterlag und eine vernichtende Niederlage erlitt.
Die Pilgerfahrt als Weltreise
Als Scheich Abu Abdallah Muhammad, später bekannt als Ibn Battuta, am 24. Februar 1304 in Tanger das Licht der Welt erblickte, war die arabisch-islamische Herrschaft längst im Niedergang begriffen. Im Herrschaftsgebiet der Mauren kriselte es schon seit langem und der politische wie militärische Druck des christlichen Lagers auf ihre Vorposten in Spanien nahm stetig zu. Weit schlimmer noch stand es im Osten des einst mächtigen arabischen Kalifats. Dort hatte der »Mongolensturm« gewütet, dem 1258 selbst Bagdad zum Opfer gefallen war.
Das demographische wie politische Antlitz der arabischen Welt hatte sich merklich gewandelt, als Ibn Battuta 1325 im Alter von 21 Jahren seine Heimatstadt verließ, um auf eine Pilgerreise nach Mekka zu gehen. Er durchquerte Nordafrika bis Alexandria und Kairo, zog dann nilaufwärts bis Assuan und gelangte so zum Roten Meer. Kriegerische Auseinandersetzungen in diesem Gebiet verhinderten jedoch die Überfahrt, so dass er nach Unterägypten zurückkehren musste, um dann über Palästina weiter nach Medina und Mekka zu reisen. Danach begab er sich durch Nordarabien und über Basra nach Persien und kehrte anschließend über Mossul und Diyarbakir erneut nach Mekka zurück, wo er gut zwei Jahre (1328-1330) verweilte. Dann zog es ihn gen Süden über den Jemen nach Ostafrika bis zum südlichen Handelszentrum Kilwa.
Nach Nordostarabien zurückgekehrt, begab er sich ein drittes Mal nach Mekka, um bald darauf eine weite Reise nach Norden anzutreten. Sie führte ihn über Ägypten, Syrien und Kleinasien bis auf die Krim und von dort weiter nach Astrachan und über das Eis der Wolga bis zum damaligen Mongolensitz Sarai (unterhalb des heutigen Wolgograd gelegen). Von Sarai aus unternahm er einen Abstecher nach Konstantinopel und fuhr anschließend sogar die Wolga aufwärts bis Bulgar unterhalb der Mündung der Kama. Von dort zurückgekehrt zog er über die untere Wolga nördlich des Kaspischen Meeres entlang und gelangte über Chiwa, Fergana, Buchara und Chorassan nach Afghanistan und von dort weiter in das damals unter islamischer Herrschaft stehende Indien. Als Rechtskonsultant und Gelehrter bekannt, hielt sich Ibn Battuta von 1333 an mehrere Jahre lang als Kadi in Delhi auf, bis ihn 1342 der Sultan von Delhi als Gesandten nach China schickte. Seine Seereise vom Golf von Kambay über Goa und Malabar nach Kalikut (Kozhikode) und weiter verlief jedoch alles andere als glatt. Längere Zwischenaufenthalte u.a. auf Ceylon und den Malediven folgten, bevor er schließlich auf dem Seeweg über Sumatra nach China gelangte, wo er von der alten Seidenstadt Zaitun (Quanzhou) aus nach Kanton, Hangtschou und Peking reiste. Zurück ging es quasi den gleichen Weg über Zaitun und Sumatra nach Kalikut und von dort nach Dhofar im nordöstlichen Arabien, wo er 1347 eintraf, um anschließend über Persien, Mesopotamien, Syrien, Palästina und Ägypten eine vierte Pilgerfahrt nach Mekka zu unternehmen. Danach trat er die Heimreise an, die ihn wieder über Ägypten mit einem Abstecher nach Sardinien zurück nach Marokko führte. Anfang November 1349 traf er schließlich in Fes ein.
24 Jahre hatte seine erste große Reise gedauert. Trotz vieler Strapazen blieb seine Reiselust ungebrochen. Nach einer kurzen Reise in die von den Mauren noch beherrschten Teile Südspaniens begab sich Ibn Battuta auf Geheiß des marokkanischen Sultans 1352 auf eine neue Tour, die in den Sudan führen sollte. Über Sigilmesa im Süden des Hohen Atlas zog er durch die westliche Sahara nach Timbuktu, damals Hauptstadt des Mali-Reiches, und besuchte weitere Städte im Nigergebiet. Nach zweijähriger Abwesenheit traf er Anfang 1354 wieder in Fes ein, wo er 1377/78 starb.
100000 Kilometer mit Kamelen und Booten
Auf seinen Reisen durch Afrika, Asien und Europa bewältigte Ibn Battuta eine Strecke von gut 100000 Kilometern. Damit dürfte er der am weitesten gereiste Mensch des Mittelalters gewesen sein. Verglichen mit Marco Polo (1254-1324), der rund 50 Jahre vor ihm die damals bekannte Welt bereist hatte, hat er wohl die dreifache Anzahl fremder Länder in Augenschein genommen. Bemerkenswert ist auch, dass Ibn Battuta meist mit einem gewaltigen Tross gereist sein soll; d.h. seine zahlreichen Frauen und Kindern waren meist mit von der Partie, und das in einer Zeit mit recht primitiven Verkehrsmitteln.
Auf Wunsch des marokkanischen Sultans diktierte Ibn Battuta seine umfangreichen Reiseberichte dem Schreiber Ibn Juzai, der sie nachträglich noch bearbeitete und so der Nachwelt überlieferte. 1355 wurde sein Reisewerk abgeschlossen und weckte zunächst ähnlich viele Zweifel wie davor Marco Polos Berichte. In der Tat sind - wie in vielen Reiseberichten jener Zeit - etliche wenig glaubhafte Fabeln enthalten. Dem Gesamteindruck, der dem Verfasser alles in allem eine gute Beobachtungsgabe bescheinigt, tut das indes kaum Abbruch. Noch heute gelten Ibn Battutas Reiseberichte als Standardwerk arabischer Reiseliteratur schlechthin. Abgesehen von Bruchstücken wurden sie in Europa aber erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts richtig bekannt; zuerst in der von Charles Defrémery und R. B. Sanguinetti herausgegebenen arabisch-französischen Fassung »Voyages d'Ibn Batouthah«, der dann bald Übersetzungen ins Deutsche und Englische folgten.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.