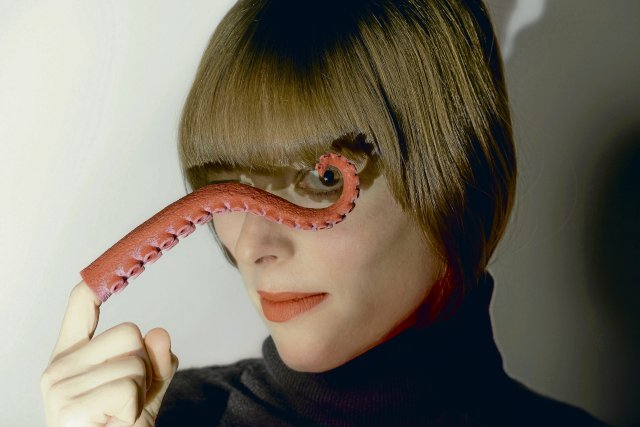- Kultur
- JEWGENI JEWTUSCHENKO: „Stirb nicht vor deiner Zeit“
Das Epochenbild eines Dichters
Gorbatschow quälen im August 1991 die Gespenster der Vergangenheit. Höhen und Tiefen seiner politischen Karriere kommen ihm in den Sinn, auch die Kindheit, als Menschen und Mäuse hungerten und die Angst alle ergriff, ob sie teilhatten an der Macht oder ihr ohnmächtig ausgeliefert waren. Seit dieser Zeit leben zwei Seelen in seiner Brust, die des Bauernsohns und die des Apparatschiks, Generalsekretärs und Präsidenten. Was der eine denkt und fühlt, sucht der andere zu verdrängen.
Jewtuschenko, seit dem „Tauwetter“ durch politische Lyrik (^Die Erben Stalins“, „Wollen denn die Russen Krieg?“) und intime Gedichte („Mit mir ist folgendes geschehn“) als einer der russischen „angry young men“ bekannt, hat sich nie gescheut, heiße Eisen anzupacken. Von der Jugend begeistert aufgenommen, war er den Ideologen ein Dorn im Auge, auch wegen der 1964 in London veröffentlichten Autobiographie und des Eintretens für Pasternak und Solshenizyn. Seine Filme „Der Kindergarten“ und „Stalins Begräbnis“ trugen zur geistigen Perestroika bei. Seine Prosa wies immer besondere Brisanz auf. Der Roman „Beerenreiche Gegenden“ (1981) enthielt verblüffende Denkanstöße, plädierte, unter Berufung auf Saint-Exupery und Garcia Märquez, für ökologische Ziele und eine Welt der Brüderlichkeit, ohne Grenzen, Ausbeutung und Krieg.
„Stirb nicht vor deiner Zeit“ (1981/93) ist wie sein Vorgänger ein Roman, der aus allen Nähten platzt, aber auch zeigt, wieviel Episches und Lyrisches, Publizistisches und Intimes, Poetisches und Triviales die Gattung aufnehmen kann. Die 35 Kapitel kreisen um jene Grundmetapher, die der Titel vorgibt: Es sei ungehörig zu sterben, solange wir uns an etwas erinnern, das für andere wichtig sein könnte. In diesem Bewußtsein hat Jewtuschenko den Roman geschrieben. Auch seine Romanfiguren geben sich Mühe, nach dieser Maxime zu leben - der Fußballer Salysin, der sich den Forderungen der Sportfunktionäre gebeugt und seine Liebe zerstört hat, der
Jewgeni Jewtuschenko, Stirb nicht vor deiner Zeit. Roman. Aus dem Russischen von Susanne Veselov Europaverlag Wien-München. 584 S., geb., 49.80 DM.
Untersuchungsrichter Paltschikow und die in Paris lebende Dichterin Anna Korsinkina, die mit siebzig zum erstenmal in ihre Heimat zurückkehren kann.
Alle Gestalten werden im August 1991 am Moskauer Weißen Haus zusammengeführt. Wählend Gorbatschow auf der Krim festgehalten wird, sammeln sie sich, um Jelzin. Sie erleben die Solidarität der Armee (für die „ein Tadshike im Panzer“ und „ein Marschall“ stehen), den Vorstoß der KGB-Einheiten, bei dem ein „Dichter des 21. Jahrhunderts“ den Tod findet, und den Zusammenbruch des Putsches. Jewtuschenko ergreift als Dichter und Volksdeputierter das Wort, rezitiert vom Balkon des Weißen Hauses ein improvisiertes Gedicht. Als Romanautor ist er sich der Problema-
tik einer künstlerisch glaubwürdigen Darstellung der Zeitgeschichte bewußt und flüchtet in Ironie, wenn er beschreibt, wie er Jelzin „im Namen des russischen Volkes“ Mut macht, oder wenn er seinen Weg als Dichter kommentiert.
1981 wollte Jewtuschenko einen Fußballroman schreiben. Zehn Jahre später „verbanden sich Putsch, Fußball und Liebe zu einem festen Knoten“ Während der Putsch sich als Drehscheibe der Romankomposition anbot und die Vorgeschichten der Politiker in Form kurzer Rückblenden erzählt werden, werden Fußball und Liebe zu Romanen im Ro-
man. Mit Salysin erinnert der Dichter an die russischen Fußballspieler der fünfziger Jahre und die eigene Sportleidenschaft, die auch in frühen Gedichten Ausdruck fand. Er gibt der Figur aber auch eine symbolische Dimension. Salysin, dem Alkohol verfallen, findet im „Leib des sozialistischen Realismus“, der bekannten Statue der Vera Muchina vor dem Moskauer Ausstellungsgelände, ein Asyl. Die Vorgänge in Rußland erscheinen ihm wie ein Spiel, bei dem niemand mehr weiß, worum es geht.
Der Liebesroman erzählt von vier Beziehungen Jewtüschenkos - zu einer „jungen Dichterin“ (Bella Achmädulina), einer Frau, die sich mutig zu ihrem Judentum bekennt und dem Autor vorwirft, in seinem Gedicht „Babi Jar“ die Tragik dieses Volkes nicht tief genug erfaßt zu haben (Galina Semjonowa), einer Engländerin, mit der er die Kinder Sascha und Toscha hat (Jane Butler), und der um dreißig Jahre jüngeren Mascha, Mutter von Shenja und Mitja. Zahlreiche Mini-Romane sind Zeitzeugen gewidmet, die unter symboli-
schen Namen auftreten - Schewardnadse als der Kosmopolitische Georgier oder Rostropowitsch als der Cello-Mann. Der Untertitel, „Ein russisches Märchen“, könnte in die Irre führen. Fast alles, was Jewtuschenko berichtet, basiert auf geschichtlichen oder autobiographischen Fakten, wirkt auch streckenweise publizistisch-kolportagehaft. Nur wenige „hypothetische“ Kapitel, die nach dem Muster „Was wäre, wenn?“ geschrieben sind, bringen jenes poetische Element in den Roman, um das der Dichter - übrigens auch in seinen Versen - seit mehr als vierzig Jahren ringt.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.