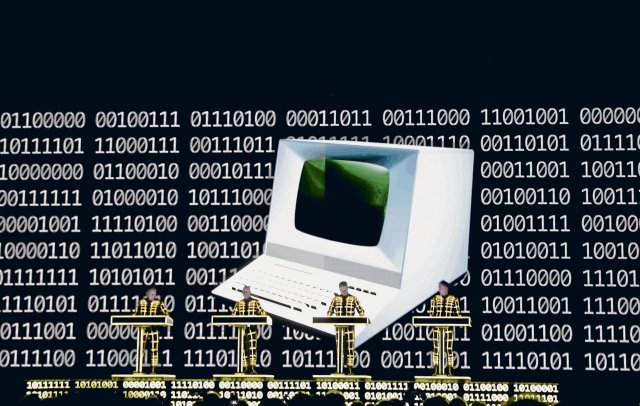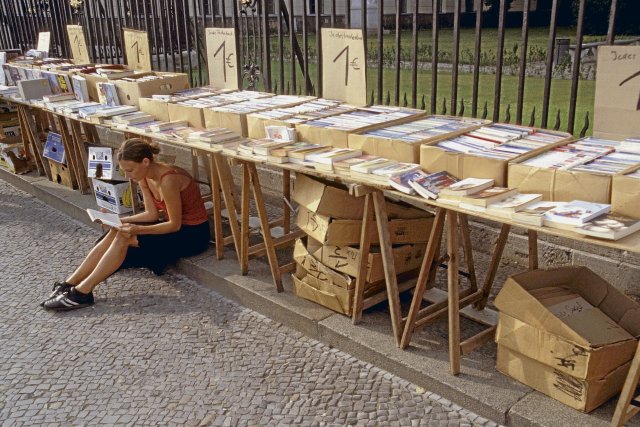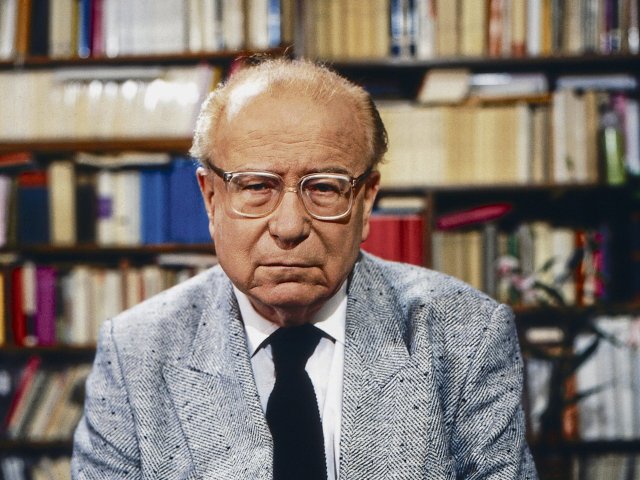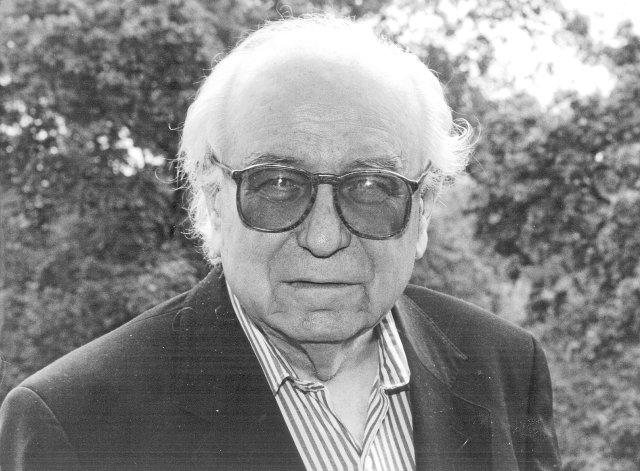Wohl kaum eine Krankheit wirkt sich so verheerend auf die Familie aus wie die Alkoholsucht. Rund zwei Millionen Kinder leben mit der Alkoholabhängigkeit eines oder beider Elternteile. Sie sind dem Karussell des Leugnens und der ständigen Angst machtlos ausgeliefert. Die Kinder lernen, ihren Eltern nicht zu trauen und ständig auf der Hut zu sein. Sie werden zu Kontrolleuren des trinkenden Vaters oder der trinkenden Mutter. Selbst wenn die Kinder das Elternhaus verlassen, die Spuren bleiben haften - oft lebenslang. Doch es gibt Hilfen und Wege aus dem familiären Suchtsystem.
Wohl kaum eine Krankheit wirkt sich so verheerend auf die Familie aus wie die Alkoholsucht. Rund zwei Millionen Kinder leben mit der Alkoholabhängigkeit eines oder beider Elternteile. Sie sind dem Karussell des Leugnens und der ständigen Angst machtlos ausgeliefert. Die Kinder lernen, ihren Eltern nicht zu trauen und ständig auf der Hut zu sein. Sie werden zu Kontrolleuren des trinkenden Vaters oder der trinkenden Mutter. Selbst wenn die Kinder das Elternhaus verlassen, die Spuren bleiben haften - oft lebenslang. Doch es gibt Hilfen und Wege aus dem familiären Suchtsystem.
Auf dem Couchtisch im Wohnzimmer zwei Schalen Bonbons. Daneben Flaschen mit Wasser. Früher war der Tisch bei Schulzes voll gestellt mit Wein oder Bierdosen. »Unsere Eltern haben morgens schon angefangen zu trinken. Statt Frühstück standen Flaschen vom Vorabend auf dem Tisch. Da hatten beide schon einen gekippt und waren Hacke«, erinnert sich Jens.
Er und seine jüngere Schwester wurden häufig ins Kino geschickt, wenn die Eltern zu Hause tranken. Die Geschwister waren sich selbst überlassen. Jeanette: »Ich habe viel geweint, wenn ich gesehen habe, wie andere Eltern mit ihren Kindern umgingen.« Jens zog sich zurück, verstummte. Wenn er heute über seine Eltern spricht, fängt er heftig an zu stottern. Den Sprachfehler ist er nicht losgeworden.
Jakobine Schulze zeigt ein Passfoto aus ihrer »Saufphase«, die inzwischen zehn Jahre zurück liegt. Auf dem Foto erscheint die heute 50-Jährige erschreckend alt und fad. Jakobine Schulze ist jetzt trockene Alkoholikerin, wie ihr Mann auch. »Damals, als ich getrunken habe, ist mir gar nicht aufgefallen, wenn die Kinder ihre Hilferufe ausgesandt haben. Sie malten mit Ketschup oder Filzstiften an den Wänden herum, waren aufmüpfig.« Auch Joachim Schulze bedauert, die Jahre mit seinen Kindern verloren zu haben. Gerade deshalb ist es ihm und seiner Frau wichtig, darüber zu sprechen. »Durch die Sucht haben wir den Kindern gefehlt, als sie uns am meisten brauchten. Auch wenn wir in der Wohnung anwesend waren, waren wir für sie nicht erreichbar.« Aber auf fatale Weise haben die Kinder ihren Eltern beistehen wollen. »Wenn ich dann aufgestanden bin - beim Zähneputzen hatte ich das Trockenkotzen. Dann haben die Kinder mir immer Bier oder Wein ins Bad gebracht und zu mir gesagt: Mama, trink das erstmal, dann geht es dir besser. Und ich dachte, das ist aber lieb von ihnen.«
Kinder werden nicht nur zu Komplizen der Sucht, sondern auch zu Kontrolleuren. Die Geschwister lernten, ihren Eltern nicht zu trauen und ständig auf der Hut zu sein. Jens nahm abends oder nachts die Flaschen und versteckte sie in seinem Zimmer. »Ich dachte, wenn die Schritt für Schritt weniger saufen, würden sie vielleicht irgendwann aufhören. Aber das hat nicht geklappt.« Wenn Schulzes kein Geld mehr für Alkohol hatten, verkauften die Eltern das Spielzeug ihrer Kinder.
Eltern, die trinken, können sich, wenn sie den Willen dazu haben, aus der Abhängigkeit befreien. Kinder aber sind der Sucht ihrer Eltern schutzlos ausgeliefert. An die Folgen haben Jakobine und Joachim Schulze damals nicht gedacht. Beide Kinder waren in ihrer Entwicklung gestört. Jeanette machte alles kaputt, was sie in die Hände bekam. »Ich habe Gegenstände zerschlagen, Tiere gequält, Leuten wehgetan.« Heute ist sie 17. Lässig sitzt sie auf dem Schoß der Mutter und lässt sich von ihr streicheln. Jakobine Schulze fällt es nicht leicht, darüber zu sprechen, was sie am meisten schmerzt. »Wenn die Kinder etwas angestellt hatten, habe ich sie viel geschlagen. Wahrscheinlich immer dann, wenn ich Ärger mit meinem Mann hatte. Und das war täglich.« Die Tochter sah mit an, wie der Vater die Türen ausgehängt hat, damit die Mutter sich nicht einschließen konnte. »Immer gab es Krach. Sie haben sich geschlagen. Meine Mutter ist mit uns drei Mal ins Frauenhaus gegangen. Ich hatte viel Angst.«
Eines Tages der Einschnitt. Jakobine Schulze: »Ich holte Jeanette ab und hatte zu Hause schon etwas getrunken. Unterwegs sind wir quer über die Straße gelaufen, obwohl fünf Meter weiter eine Ampel stand. Sie riss sich los und saß vorn auf der Motorradhaube. Hätte ich nicht gesoffen, wäre das nicht passiert. Ich bin Gott dankbar, dass ich sie noch habe.« Für Jakobine Schulze war dies der Wendepunkt. Von da an hörte sie auf zu trinken. Ihr Mann wenig später auch. »Wir haben beide einen Familientherapeuten aufgesucht. Auch für die Kinder haben wir uns um eine Therapie bemüht, schließlich wollten wir alle etwas ändern.«
Die Kinder mussten jetzt mit trockenen Eltern umgehen. Und umgekehrt. Auch das war nicht einfach. »Jetzt erst merkten wir, wie schwierig die Kinder waren. Da habe ich abends oft gesessen und geheult, wenn sie im Bett lagen. Erst von diesem Zeitpunkt an war mir bewusst, was wir den Kindern angetan hatten. Da hätte ich öfter einen Grund gehabt, wieder zur Flasche zu greifen.« Doch das hat sie nicht getan. Regelmäßig besuchen Schulzes die Selbsthilfegruppe im Berliner Kreuzbund.
Jeanette puzzelt viel, um sich abzulenken. Es beruhige sie, um nicht mehr an diese Zeiten von früher zu denken. Der Vater versucht, den beiden Heranwachsenden Nähe und Unterstützung zu geben. Dafür sei es nie zu spät, hofft er. Auch wenn sich die Eltern von der Schuld nicht mehr in ihrer Handlungsfreiheit blockieren lassen wollen, machen sie sich Vorwürfe. »Das ist ihre Kindheit, die kann man nicht nachholen«, sagt Jakobine Schulze. Sich eine heile Familie vorgaukeln, das können sie aber nicht. Jeanette: »Ich habe zu Mutti gesagt, dass sie das wahrscheinlich nie wieder gut machen kann. Die Schmerzen, die ich damals hatte, die habe ich heute manchmal noch, wenn ich daran denke. Ich glaube, diese Erinnerungen werden auch niemals vergehen.«
Auch Joena war der kranken Familie hilflos ausgeliefert. Aggressionen, Gewalt, Polizeieinsätze gehörten zu ihrem Alltag. Joena, die sich in die Verantwortung stürzte, den Haushalt führte, die betrunkenen Eltern tröstete und zugleich hasste. Eines Tages wies das Jugendamt Joena in ein Heim ein. Zunächst war dies eine Erleichterung für das Mädchen. Denn jetzt konnte sie die Perspektive wechseln. »Ich konnte im Heim einfach Kind sein. Ich hatte nicht bemerkt, dass ich bei meinen Eltern längst kein Kind mehr, sondern schon erwachsen war.« Joena war aber so gewöhnt an das suchtkranke Leben, dass sie sich trotz räumlicher Distanz weiterhin für ihre Eltern verantwortlich fühlte. Heimlich ging sie nach der Schule nach Hause, um nach ihnen zu sehen. Taschengeld, das sie im Heim erhielt, brachte sie ihnen für den Alkohol.
Silvia Dietze hat Joena damals betreut. »Sie wollte wissen, wird zu Hause noch weiterhin getrunken? Sind die Eltern weiterhin böse zueinander? Joena fühlte sich schuldig, denn die Eltern tranken weiter, obwohl sie nicht mehr zu Hause war. Und nun war sie erst recht Schuld, weil sie nicht mehr aufpassen konnte und zugleich niemand mehr da war, der den Eltern Alkohol besorgen konnte.«
Joena ist nicht nach Hause zurückgekehrt. Sie zog in eine Wohngemeinschaft und fand so etwas wie eine Ersatzfamilie. Dazu Geborgenheit und Wärme. Joena muss jetzt einsehen, dass sie ihre Mutter wahrscheinlich für immer an den Alkohol verloren hat. Die Mutter ist psychisch erkrankt. »Sie weiß nicht mehr, was sie früher gemacht hat. Sie weiß gerade noch, dass ich ihre Tochter bin und wie ich heiße. Damit komme ich nicht klar. Kürzlich war ich so sauer auf sie, dass ich plötzlich Sachen wie mein Handy durch die Gegend schleuderte. Ich konnte nicht mehr. Ich mache mir immer Gedanken: Hoffentlich werde ich nicht wie meine Eltern. Hoffentlich ende ich nicht wie meine Mutter.«
Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ist unausweichlich. Rechtzeitige Hilfe erhöht die Chance, aus dem Suchtsystem herauszufinden. Joena besucht seit einigen Monaten in Berlin-Neukölln eine Selbsthilfegruppe der AG »Hilfe für Kinder und Jugendliche suchtkranker Eltern«. Sie ist nicht mehr so abhängig von ihren Eltern, achtet nicht mehr so auf sie. »Was ich will, was ich mache, kann ich jetzt ganz für mich allein entscheiden.«
Nicht selten werden Kinder alkoholkranker Eltern selbst abhängig. In Entwöhnungseinrichtungen für Alkoholiker gibt jeder dritte Patient an, dass mindestens ein Elternteil Probleme mit Alkohol hat oder abhängig ist. Auch bei Zieglers türmten sich zu Hause die Bierkästen. Der heute erwachsene Sohn hatte seinen ersten Vollrausch mit acht Jahren, den zweiten mit zwölf. »Mit vierzehn fing ich an, regelmäßig zu trinken. Später habe ich mir das immer so ausgelegt: Mein Feierabendbier, das kann mir keiner nehmen. Das steht mir einfach zu. Ja, ich habe mir die Welt schön gesoffen.«
Der Kraftfahrer Hayo Ziegler ist verheiratet, hat eine Tochter. Andrea ist 15 Jahre alt und »heilfroh«, dass der Vater mit dem Trinken aufgehört hat. Trotzdem hat sie nichts vergessen. »Er hat mich ignoriert, als wenn er in einer eigenen Welt lebt und ihm alles scheißegal ist.«
Der Alltag bei Zieglers war unberechenbar. Der Alkohol veränderte Vaters Stimmung urplötzlich. Gerade noch nervös, plötzlich gut gelaunt. Gerade noch in Mitleidsstimmung, plötzlich gereizt. Ihre eigenen Gefühle musste Andrea zurückhalten - wenn sie einsam, wütend oder enttäuscht war, sich schämte oder fürchtete. Die Gefühle, die sie hatte, konnte sie nicht zeigen, und die Gefühle, die sie zeigte, stimmten nicht. »Ich hatte sehr viel Angst vor meinem Vater, obwohl ich wusste, dass er mir nichts tun würde. Ich hab mich schuldig gefühlt. Ich dachte, vielleicht habe ich ihm ja die Probleme gemacht. Vielleicht säuft er deshalb so.«
Wenigstens trank die Mutter nicht. Trotzdem war auch Andrea sich selbst überlassen. Denn durch die Sucht des Ehemannes war die Mutter ganz auf ihn fixiert. Frau Ziegler weiß heute, wie verstrickt sie selbst in das kranke System war: »Ich denke, dass ich Andrea nicht genug beschützt habe. Ich habe versucht, sie da rauszuhalten, sie zu einer Nachbarin gebracht, damit sie nicht so viel mitkriegt. Aber es geht immer auf das Kind.«
Ins Suchtsystem sind alle Familienmitglieder verstrickt. Ein ständiges Wanken zwischen Ohnmacht und Täuschung, Verzweiflung und Hoffnung. Andrea erinnert sich daran, wie es immer hieß: Jetzt trinkt er nicht mehr. Jetzt wird alles wieder gut. Bald darauf jedoch erlebte sie, wie er schon wieder aus einer Kneipe kam. »Wenn ich das heute nüchtern betrachte, hatte ich zu meinem Kind damals gar keinen Bezug, obwohl ich mir das eingebildet hatte. Ich legte mir alles so zurecht, dass ich saufen konnte«, bilanziert Hayo Ziegler. Seine Frau bereut, dass sie inkonsequent war und ihm immer ein Hintertürchen offen hielt. »Ich hätte sagen müssen: So, aus, fertig, ich gehe jetzt.«
Vor acht Jahren war Hayo Zieglers Gesundheit ruiniert. Seitdem hat er es geschafft, trocken zu bleiben. Jeden neuen Tag nimmt er als Geschenk und hofft, dass Frau und Tochter ihm eines Tages verzeihen können. »Ich habe das verdammte Glück gehabt, wirklich im letzten Moment noch die Kurve zu kriegen, bevor meine Tochter einen vielleicht noch größeren Schaden genommen hätte. Ich denke, es ist auch noch nicht alles aufgearbeitet. Dazu bedarf es Zeit.« Andrea hat Angst, der Vater könne rückfällig werden. Dennoch ist er ihr ein und alles. Den Vater wieder nüchtern erleben zu können, macht es auch leichter, ihm zu verzeihen.
»Es hätte zwar nicht so sein müssen, natürlich nicht. Aber ich finde es gut, dass wir uns trotzdem jetzt gut verstehen. Und das mit meiner Mutter, das hat auch total zusammengeschweißt, weil, wir haben das ja auch zusammen durchgemacht und das schweißt zusammen." Hayo Ziegler warnt eindringlich: "Ich kann eben nur heute die Vorraussetzung schaffen, daß ich morgen trocken bleibe. Wenn ich heute aber herumlüge, und mir die Taschen voll mache, dann funktioniert das nicht mehr, dann kriege ich so ein schlechtes Gewissen, dann baut sich so ein psychischer Druck auf, dass ich vielleicht wieder saufen gehe. Und das will ich nicht. Die Zeit, die ich früher versoffen habe, die verbringe ich heute mit meinem Kind." Manchmal reden sie über das Vergangene, manchmal spielen sie es sich von der Seele. Text und Noten auf Andreas Schoß. Der Vater die Gitarre in der Hand. Andrea entwirft auch eigene Texte. Gedichte. Das Schreiben war für sie ein Rettungsanker vor der Sucht.
Oft bleiben die Folgen der elterlichen Sucht ein Leben lang haften. Für Kinder alkoholkranker Eltern ist die Gefahr, selbst eine Suchtkrankheit, Ängste oder Depressionen zu entwickeln, deutlich erhöht. Ute Rosenhagen ist 46. Sie hat sich ein Ventil gesucht, um die Kindheit zu verdrängen. Ständig ist sie am Putzen. »Ich habe den Wunsch, meine Seele aufzuräumen. Ich fühle mich nur wohl, wenn ich etwas sauber gemacht habe.«
Es ist der Geruch von Alkohol, den sie nicht los wird. Die Bilder, wenn er besoffen im Bad lag und das Ausgebrochene die ganze Wohnung überlagerte. Die Schläge, die in dieser Familie nicht nur die Mutter bekam. Blaue Flecke am Körper und Blutergüsse hatte auch die Tochter. Und immer die Ohnmacht dabei, sich nicht wehren zu können. Ute Rosenhagen wurde von ihrem Vater vergewaltigt. Mehrfach. »Ich habe mich häufig gefragt, ob das niemand im Haus hörte. Ich habe ja auch geschrien. Später lernte ich, stumm zu sein. Ich weiß nicht, ob sich mein Vati da noch mehr herausgefordert gefühlt hat.«
Die Mutter ließ das Kind allein. Sie unternahm nichts. »Manchmal kam sie mir auch hilflos vor, vielleicht hatte sie auch Angst, die drei Kinder allein zu versorgen.« Sie blieb bei ihm. Das Schlimmste für das Kind: Vater und Mutter bezichtigen es der Lüge. Zu diesem Zeitpunkt beging Ute Rosenhagen den ersten Selbstmordversuch. Sie, die den Vater doch eigentlich liebte und stolz war auf den damaligen Offizier der NVA. »Das waren immer zwei Gefühle. Auf der einen Seite hat er etwas dargestellt in seiner Uniform. Auf der anderen Seite, wenn er trank, torkelte, stürzte, nur noch lallte oder herumschrie, das waren eben zwei Gesichter.«
Menschen, die trinken, meidet Ute Rosenhagen. Um Kioske macht sie einen großen Bogen. Steigt ein Betrunkener in die U-Bahn, wechselt sie das Abteil. Auf Dienstreisen umgeht sie Arbeitsbesprechungen, bei denen getrunken wird. Die entstehende Heiterkeit ist ihr unangenehm. Ute Rosenhagen leidet unter Depressionen und einer Angstneurose. »Ich habe vor Enttäuschungen Angst. Immer wenn ich eine Partnerschaft hatte und jemand gesagt hat, ich liebe dich, bin ich gegangen. Andererseits wünsche ich mir Liebe. Zur Zeit fliehe ich in die Arbeit, weil ich mich so am wohlsten fühle.«
Jeder sucht seinen Weg. Ute Rosenhagen hat sich in therapeutische Behandlung begeben. Einen Halt findet sie auch im Glauben. »Ich nehme an, dass es der Vater im Himmel ist, der mir den Weg gezeigt hat. Für mich ist er ein Schutzengel, der immer beide Hände über mich hält und sagt, Ute, du bist ein wertvoller Mensch, du kannst weitergehen. Und dann tanke ich so viel Kraft, dass ich nicht mehr an Selbstmord denke, sondern einfach nur: Ute es geht weiter.«