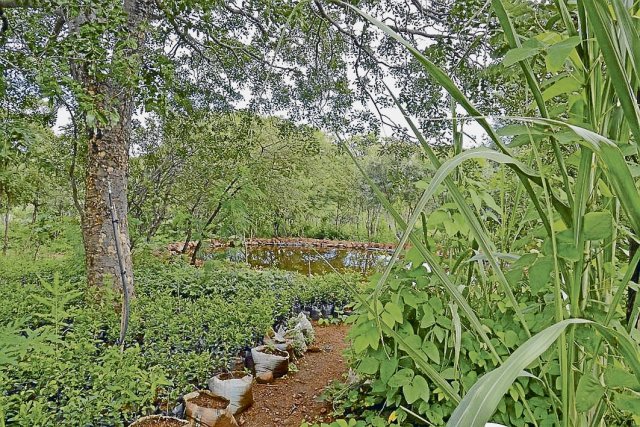Wollenbergers Gegendarstellung
»IM Donald« wollte immer ein Buch schreiben, aber nie über sich. Jetzt erschien ein Lyrikband
Ex-Mann Knud Wollenberger schwieg. Er hatte dem DDR-Ministerium für Staatssicherheit (MfS) jahrelang unter dem Decknamen »IM Donald« über den oppositionellen »Friedenskreis Pankow« berichtet, und auch darüber, was seine Ehefrau dort so machte. Allerdings nichts Intimes, wie er beteuert. Seine Enttarnung als IM im Jahre 1992 erregte Aufsehen. Lengsfeld, die seinerzeit noch für Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag saß, ließ sich scheiden. Es stellte sich heraus, dass das MfS in Sachen Friedenskreis mit grotesk anmutendem Aufwand vorging.
Das Buchprojekt
Im Jahre 1997 erwog ein Berliner Verlag, eine Autobiografie von Knud Wollenberger herauszugeben (Arbeitstitel: »Mein Leben mit Vera«). Lengsfeld trat bei der Bundestagswahl 1998 wieder in Thüringen an. Medienwirksam und unbedingt noch rechtzeitig vor dem Urnengang sollte das Werk herauskommen. Daraus ist nichts geworden, weil Knud Wollenberger an einem solchen Buch letztlich kein Interesse zeigte.
Ihm lag immer nur an einem Lyrikband. Als 14-Jähriger lebte er mit dem diffusen Wunsch, Schriftsteller zu werden. Als 19-Jähriger begann er Gedichte zu schreiben. Manuskripte schickte er nach 1989 vergeblich an Rowohlt, Luchterhand und Suhrkamp. Die kleinen Verlage mied der schmächtige Lyriker, bis er schwer erkrankte. Mit dem Wissen um den möglicherweise nahen Tod wandte er sich an den Peter Segler Verlag. Da klappte es. 64 Gedichte vereint »Azurazur« auf 105 Seiten.
Die Krankheit
Einige Gedichte stammen aus den 70er Jahren, so »Märchenende« und »Entwurf für Denkmal«. Einiges entstand in den 70er Jahren, das meiste aber ab Ende der 90er. Die erste Auflage kam kurz vor Weihnachten auf dem Markt. Die Buchpremiere gab es erst Ende Februar im Berliner Café Walden. Dabei ließ der kranke Wollenberger seine Texte von Bekannten lesen. Bedingt durch die Krankheit, versagt seine Stimme häufig. Öffentlich vorlesen, das klappt nicht mehr.
Der Mann leidet unter Multipler System-Atrophie (MSA). Die Ärzte diagnostizierten diese seltene, Parkinson-ähnliche Erkrankung im Jahr 2001. Die Betroffenen landen üblicherweise schon nach zwei Jahren im Rollstuhl. Der Tod ereilt sie im Schnitt nach acht bis neun Jahren. MSA zerstört Nervenzellen und ist unheilbar. Knud Wollenberger hat einen MSA-Typ, bei dem der Körper den Blutdruck nicht mehr regulieren kann. Einmal ist er schon ohnmächtig geworden.
Weiter als fünf Kilometer kommt er zu Fuß nicht mehr. Die linke Seite ist fast gelähmt. Das Bein schleppt er nach. Aber an den Rollstuhl ist Wollenberger noch nicht gefesselt. Auf eine solche Situation eingestellt hat er sich bereits. Vor zwei Jahren zog er in eine behindertengerechte Plattenbauwohnung in Berlin-Buch, verließ das selbst ausgebaute Domizil unter dem Dach am Pankower Amalienpark, wo die Wollenbergers seit den 80er Jahren lebten. Dort nahm einst Manfred Stolpe Platz in einem Sessel, wie Wollenberger erzählt. Als Vertreter der evangelischen Kirche sprach der Mann, der heute Bundesverkehrsminister ist, damals mit dem Pankower Friedenskreis.
Warum Knud Wollenberger der eigenen Frau verheimlichte, dass er mit dem MfS plauderte, bleibt unerklärlich. »Das war der größte Fehler meines Lebens«, bekennt Wollenberger. Dann schränkt er noch ein: »Weil ich einen größeren Fehler nicht begangen habe.«
Die Herkunft
Eine offensichtlich zerrüttete Ehe taugt nicht als Begründung für Wollenbergers Schweigen. Der Blick in seine Lebensgeschichte hilft, aber nur ein klein wenig.
Vater Albert war ein deutscher Jude, der 1932 in die Kommunistische Partei eintrat. Vor den Nazis flüchtete er in die USA. Dort bekam er während der McCarthy-Ära Schwierigkeiten. Als Kommunist und Gegner des Koreakrieges wurde er 1947 verhaftet und erst durch Intervention von Albert Einstein auf Bewährung freigelassen. Albert Wollenberger verließ die USA, lernte in Dänemark seine spätere Frau kennen, wurde Vater. 1954 ging er in die Hauptstadt der DDR. Hier forschte der renommierte Biochemiker an einem Institut für Herzkreislauf-Erkrankungen.
Die ständig wachsende Familie bezog eine Villa in Buch. Knud hat sechs jüngere Schwestern. Er selbst wurde 1952 noch in dem Kopenhagener Vorort Frederiksberg geboren und ist bis heute- wie seine Mutter- dänischer Staatsbürger. Nach einer Berufsausbildung als Agrotechniker mit Abitur studierte Knud von 1971 bis 1975 Mathematik. Er verdiente seine Brötchen im VEB Getränkekombinat Berlin, in der Akademie der Wissenschaften und schließlich als selbstständiger Imker.
Der Informant
Dem MfS verpflichtete er sich schon als Student. Die Zusammenarbeit schlief aber ein. Als 1981 der oppositionelle »Friedenskreis Pankow« entstand und Knud Wollenberger da mitmischte, erinnerte man sich im Ministerium an den alten Informanten. Der Friedenskreis sei kein Geheimbund gewesen, rechtfertigte sich Knud Wollenberger einmal. Man wollte ja, dass der Staat zuhört und auf Forderungen eingeht. Doch warum hielt Wollenberger sich an die Regeln der Konspiration? Warum akzeptierte er die Rolle eines IM und verheimlichte die Treffen mit seinem Führungsoffizier vor der Ehefrau? Sie hätte das nicht verstanden, sagte er.
Immer noch sieht sich Wollenberger als Oppositioneller: »Ich wollte eine bessere DDR.« Er wollte einen Staat, in dem Juden vor faschistischer Verfolgung sicher sind. Die Berliner MfS-Abteilung XX/4, die sich mit Kirchenfragen beschäftigte, sei auf Reformen in der DDR aus gewesen. Ist das die Wahrheit, eine Selbsttäuschung oder eine Schutzbehauptung Wollenbergers? Bei diesem Thema bleiben viele Fragen offen. Tatsache ist, dass inzwischen etliche
MfS-Offiziere schilderten, sie hätten bestimmte Berichte geschrieben, damit die Verhältnisse in der DDR sich verbessern.
Die Konfrontation
1988 kam es zum Zwischenfall bei der offiziellen Liebknecht-Luxemburg-Ehrung. Im Demonstrationszug tauchte das Luxemburg-Zitat mit der Forderung nach der Freiheit der Andersdenkenden auf. Vera Lengsfeld plante, mit einem Transparent an die in der Verfassung verbriefte Meinungsfreiheit zu erinnern. Auf dem Weg zur Demonstration wurde sie verhaftet und schließlich zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Ihr Anwalt Wolfgang Schnur, 1990 als IM entlarvt, täuschte sie. Er log der im Gefängnis Sitzenden vor, dass draußen kaum Solidarität mit ihr bekundet werde. Damit erleichterte er Vera Lengsfelds Entschluss, nach England auszureisen. Offenbar wünschte sich die DDR-Führung die Ausreise, um einen Störenfried los zu sein.
Auch Gregor Gysi war als Anwalt von Knud Wollenberger in die Angelegenheit involviert. Eine von Gysi unterschriftsreif gemachte Vereinbarung legte fest, dass Knud Wollenberger bis zum 22. Februar 1988 über den Aufenthaltsort der beiden gemeinsamen Kinder entscheiden dürfe. Nach Wollenbergers Ansicht blockierte das die von oben angestrebte Ausreise. Es war völlig klar: Ohne ihre Söhne verlässt Lengsfeld die DDR nicht. Gysi habe deshalb damals durchaus seine Lizenz riskiert, meint Wollenberger anerkennend. Lengsfeld sieht das anders. In ihrem Buch »Mein Weg zur Freiheit« macht sie Gysi heftige Vorwürfe.
Als Lengsfeld schließlich doch nach England ging, wirkte das wie ein Zurückweichen vor der Staatsmacht. Das habe der Opposition psychologisch schwer geschadet, berichtet Wollenberger heute. Das sei aber »Schnee von gestern«. 14 Tage früher oder später wäre die DDR so oder so untergegangen.
Knud Wollenberger redet nicht gern über die alten Zeiten, auch nicht über seine lange Arbeitslosigkeit nach 1992. Er muss jetzt mit 500 Euro Berufsunfähigkeitsrente und 200 Euro Pflegegeld im Monat auskommen. Politik kümmert ihn seit ein paar Jahren kaum noch. 1999 las er Gedichte in Weimar- in Vera Lengsfelds Wahlkreis. Er dachte, es müssten doch Zwischenrufe kommen, aber es sei keiner gekommen. »Da habe ich etwas gelernt über die Bedeutung von Politik.«
Der Lyriker
Wollenberger möchte im Prinzip nur über seine Gedichte reden. Seine Texte sind sehr persönlich und zuweilen politisch. So dichtet er: »Irgendwo in Buch liegen Hitlers Reste/ verscharrt/ das wusste ich als Kind schon... Aus Hitlers Grab können doch nur die giftigsten Pilze sprießen.« Deutsche Geschichte, die habe er doch von früh an- »gegessen und überlebt.« Andere Zeilen lauten: »Mein Gehirn will nicht noch mehr abstürzende World Trade Center« und »Wenn ich an die DDR denke/muss ich an Plaste und Elaste aus Schkopau denken... Arbeitsbeginn ist/ 06:00 früh. Mach doch ne Eingabe...«
Nur den Dichter Paul Celan hält Wollenberger für besser als sich selbst. Diese Selbstüberschätzung verblüfft. Aber wenn er auch nicht gleich nach Celan kommt, untalentiert ist der Lyriker Wollenberger keineswegs. Er verfügt über Humor und Beobachtungsgabe. Mit dergleichen Gaben errang er bei deutschlandweiten Slams zwei vierte Plätze- bei jenen Leseshows vor hunderten Zuschauern, bei denen Spaß und Vortragsweise entscheiden. Wenn die Umstände ihn nicht als IM bekannt gemacht hätten, dann schriebe wohl niemand so lange Artikel über die Person Wollenberger. Aber in kleinen Artikel würde dann mehr über sein literarisches Werk stehen. Eine in Gedichtform abgefasste Gegendarstellung zu Lengsfelds Büchern plante Wollenberger nicht. Trotzdem ist eine Art Gegendarstellung entstanden. Geradegerückt scheint nun die Ansicht, er sei nicht mehr als der Ex-Mann und der Ex-IM.
Knud Wollenberger: Azurazur, Peter Segler Verlag Freiberg, 105 Seiten, 8,60 , www.segler-verlag.de
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.