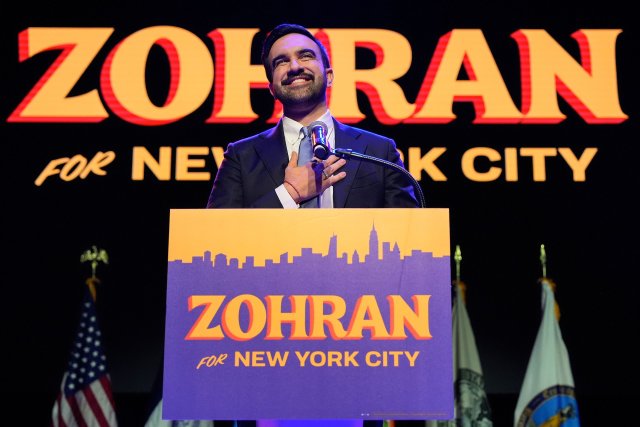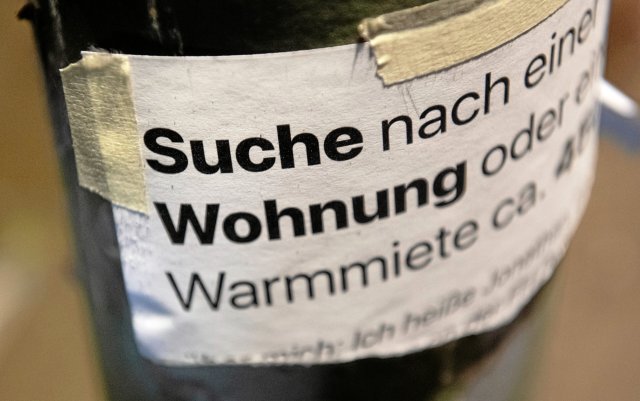Wo Genossin Sonne einheizt
Ein sächsischer Unternehmer steigt Hausbesitzern mit alten, neuen Ideen aufs Dach
Buschbeck sitzt allerdings nicht vor dem Zähler, sondern steht in einer Fabrikhalle seiner Firma und zeigt, wie die Zielscheiben für die Sonnenenergie entstehen. Lange Bahnen gewellten Kupferblechs werden mit dünnen Rohren verlötet, Spanplatten und Latten zu Kisten genagelt, ein Gewirr von Leitungen, Ventilen und Skalen an einen dicken Kessel montiert. In gepolsterten Gestellen stehen Glasplatten, daneben unscheinbare Steckschienen, die an Möbel-Zierleisten erinnern. Die Schienen, mit denen sich Glasscheiben absolut dicht verbinden lassen, sind der eigentliche Kniff für seinen Erfolg, sagt Buschbeck: Sie machen aus einer Sonnenheizung »ein richtiges Dach«.
Anlagen, die das Dach ersetzen
Buschbecks Firma setzt die Wärme der Sonne zum Heizen von Häusern ein. Die Idee ist alles andere als neu. Seit Jahrzehnten werden dunkle Kunststoffschläuche und schwarze Rohre auf Dächern montiert, um Heiz- und Duschwasser aufzuwärmen. Aus der ökologischen Nische ist das »Solarthermie« genannte Prinzip jedoch lange Zeit nicht herausgekommen: Zu teuer waren die Installationen, die auf die Dachschindeln montiert wurden. An genau diesem Punkt hat Buschbeck angesetzt. »Unsere Anlagen kommen nicht auf das Dach«, sagt er, »sondern sie ersetzen das Dach.«
Statt Ziegel, Schiefer oder Reet, so die Idee, bekommen die Hausbesitzer flache, schwarze Sonnenkisten auf die Dachsparren gepackt. Über den ästhetischen Wert lässt sich streiten, über den ökonomischen Nutzen nicht. Bis zu 60 Prozent der Kosten für Heizung und Warmwasserbereitung lassen sich in einem Haus mit Sonnendach und guter Dämmung sparen, sagt Buschbeck. Er packt seine Kunden nicht zu allererst beim Umweltbewusstsein, sondern beim Geldbeutel. »Wenn ein Schiefer- und ein Sonnendach gleich teuer sind«, sagt er, »stellt sich viel eher die Frage, warum man das Dach nicht auch noch heizen lässt.«
Buschbeck hat sein Unternehmensprinzip in einen Werbeslogan gepackt. »Solartechnik, die sich rechnet«, steht neben dem gelb-grauen Firmenlogo an der Hallenwand. Die Idee scheint so gut zu funktionieren, dass man ihren Erfinder einen »Sonnenkönig von Augustusburg« nennen könnte. Er beschäftigt 40 Menschen, im Sommer noch ein paar mehr. Sie arbeiten in zwei großen Hallen, die im Ortsteil Erdmannsdorf neben der Kirche und am Ufer des Zschopau-Flusses stehen. In der einen Halle saß einst ein Unternehmen für Fluidtechnik. Es wurde nach 1989 von der Preussag übernommen, die dann in einem Touristikkonzern aufging und ihre Erdmannsdorfer Filiale abwickelte. In der anderen Halle produzierten Textilbetriebe, die schon das Ende der DDR nicht überlebt haben. Gemessen daran hat Buschbeck in der Kleinstadt vor den Toren von Chemnitz so etwas wie ein kleines Wirtschaftswunder bewerkstelligt.
Dabei waren die Anfänge der Firmengeschichte alles andere als vielversprechend. Buschbeck begann 1993, aus einer Garage heraus mit Sonnenheizungen zu handeln. Den gelernten Elektriker und früheren Punk, der mit politisch unorthodoxen Ansichten schon in der DDR-Berufsschule oft angeeckt war, hatte die Aussicht wenig begeistert, als Angestellter einer Elektrofirma durch Kabelschächte zu kriechen. Der 39-Jährige, der das Ende der DDR-Planwirtschaft als »Befreiung« empfand, sah sich als »Vollblutunternehmer«, der »immer Ideen hatte und diese umsetzen musste«.
Binnen Monaten hatte Buschbeck damals jedoch lernen müssen, dass die Marktwirtschaft anderen Gesetzen gehorcht als die DDR-Nischenproduktion. Deren Produktpalette hatte er als Jungfacharbeiter mit begehrten Spannungswandlern für den Trabant bereichert, die er zwar ohne Genehmigung herstellte, nach Kleinanzeigen in der Bezirkszeitung aber reißend los wurde. Seine Solaranlagen dagegen wollte niemand haben: »Nach einem halben Jahr stand ich mit nach außen gekrempelten Taschen da.«
Weil Buschbeck aber nicht nur erfinderisch ist, sondern auch ehrgeizig, sind die Taschen inzwischen wieder gefüllt. Das Geschäft mit der Sonnenwärme brummt. Obwohl aus der Doppelgarage zwei Werkhallen geworden sind, kann Buschbecks Firma die Nachfrage kaum befriedigen. Der Absatz wuchs seit der Gründung der Solardach-Firma vor sieben Jahren von 2000 auf über 40000 Quadratmeter; die Kurve zeigt weiter steil nach oben. Nichts läge daher näher, als Buschbecks Geschichte augenzwinkernd als die eines »Bill Gates von Augustusburg« zu erzählen - in Anlehnung an den Chef des Weltkonzerns Microsoft, der ebenfalls in einer Garage begann und heute ein Quasimonopol bei Betriebssystemen für Computer innehat.
Der Augustusburger Sonnendach-Fabrikant indes ist nicht nur kein sächsischer Bill Gates; er ist überhaupt kein Unternehmer aus dem Kapitalismus-Lehrbuch. Dass er örtliche Kultur- und Sportaktivitäten fördert, fällt noch vergleichsweise wenig aus dem Rahmen. Dass Buschbeck bestrebt ist, der andernorts verbreiteten Auslagerung von Produktionsabläufen an billigere Standorte zu trotzen und große Teile der Wertschöpfung in den eigenen Hallen zu konzentrieren, mag man für skurril halten. Demnächst werden auch noch die bulligen Kessel für die Wärmespeicherung selbst geschweißt. Nur die schwarze Schicht, die aus einer Spezialfarbe besteht und auch schwache Sonnenstrahlung höchst effektiv für die Wärmeerzeugung ausbeutet, kommt in Dänemark aufs Blech.
Vollends erschüttert wird das Bild vom Musterunternehmer aber schließlich durch den Umstand, dass Buschbeck gern wortreich über das herrschende Wirtschaftssystem, vor allem jedoch über die Akkumulation von Kapital und ihre fatale Wirkung auf Wirtschaft und Gesellschaft wettert. Er hält es für höchst problematisch, dass es gegenwärtig lukrativer ist, Geld aufzuhäufen und auf Zinsgewinne zu spekulieren, als in neue Unternehmungen und Arbeitsplätze zu investieren: »Wir brauchen«, sagt er, »einen dritten Weg.«
Angesichts solcher für einen Unternehmer ungewöhnlichen Ansichten scheint es nur konsequent, dass er auch für Vertrieb und Montage seiner Dächer auf ein unorthodoxes Modell setzt, das unternehmerische Aspekte mit dem Gemeinschaftsgedanken in Übereinkunft zu bringen sucht. Gemeinsam mit derzeit 100 Installationsfirmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz hat er vor einem Jahr eine Genossenschaft gegründet. Sie nennt sich »Bund Solardach«. Die Bezeichnung hat nicht nur den Vorteil, dass die Abkürzung »Buso« dieselbe ist wie die für Buschbecks Sonnendach-Firma. Der Begriff »Bund« ist auch als Bekenntnis gedacht. Dokumentiert werden solle der Umstand, dass Produzent und Montagebetriebe gleichberechtigt und partnerschaftlich arbeiteten, sagt der Unternehmer: »Wir sehen uns als eine Gemeinschaft und wollen das zeigen«.
Dieser Genossenschaftsgedanke mag in den gut 150 Jahren, seit Hermann Schulze-Delitzsch in Sachsen die erste deutsche Rohstoffgenossenschaft gegründet hat, an Popularität eingebüßt haben. Der »Bund Solardach«, dessen 100 Genossen sich am letzten Februar-Wochenende in Augustusburg zu ihrem ersten Jahrestreffen versammelten, beweist allerdings, dass angestaubtes Image nicht gleichbedeutend mit mangelnder Wirksamkeit ist. Zu den Vorteilen gehören laut Buschbeck die intensive Schulung der Partner sowie kurze Handelswege, die den Kunden in Form niedrigerer Preise und den Montagefirmen in Form guter Absätze zugute kommen.
Hauptzweck der Genossenschaft ist es indes, für die Sonnendächer zu werben. Das ist nötig, denn weil nur 100 Genossen für den »Bund Solardach« arbeiten, sind diese zwar sehr professionelle Monteure; der Weg vom potenziellen Kunden zu ihnen ist aber im Zweifelsfall lang. Kleinanzeigen nutzen also wenig. Doch Buschbeck hat den Vertriebsweg für seine Trabant-Spannungswandler längst als untauglich für die Marktwirtschaft erkannt. »Buso« wirbt heute auf den Seiten der Internet-Suchmaschine »Google«. Wenn ein dem Thema Sonnendach nur annähernd nahe stehender Begriff eingegeben wird, taucht ein Verweis auf die Buso-Homepage auf. Das Konzept ist teuer, aber wirksam: »Unsere Seite ist inzwischen die am stärksten frequentierte der ganzen Branche«, sagt Buschbeck. Und nicht nur das: Anfragen nach Sonnendächern kommen inzwischen aus Irland, England und sogar den USA, einem »Entwicklungsland in Sachen Sonnenenergie«, wie Buschbeck sagt.
Solarier aller Länder, vereinigt euch!
Solche Werbeerfolge lassen Buschbeck ebenso zuversichtlich in die Sonne schauen wie der kräftig steigende Ölpreis, der eine unabhängige Energieversorgung immer lukrativer erscheinen lässt. Zehn Jahre dauert es derzeit, bis sich ein Sonnendach über die niedrigeren Heizkosten amortisiert hat. Dazu trägt auch eine üppige staatliche Förderung bei. In naher Zukunft, glaubt der Unternehmer, dürften weiter steigende Preise für Öl und Gas und eine höhere Effizienz bei der Herstellung aber sogar dazu führen, dass Solarenergie auch ohne Hilfe vom Staat rentabel genutzt werden kann.
Dass Buschbeck nicht ganz falsch liegen kann, zeigt der Umstand, dass immer mehr Solar-»Großkraftwerke« errichtet werden, in denen Strom aus Sonnenenergie gewonnen wird. Wirtschaft und Banken sind enthusiastisch. Die wesentlich weniger anspruchsvolle Technologie, die Wärme der Sonne zum Heizen zu nutzen, stößt dagegen auf geringeres Interesse. Buschbeck wundert das nicht. In die Photovoltaik-Anlagen würden »die Reichen investieren«, während alle anderen über die staatlich garantierte Einspeisevergütung »die Zeche zahlen«. Das Modell sei damit »kapitalismuskonform«. Mit Sonnendächern könnten dagegen nur »kleine Leute sparen«. Das sei, sagt Buschbeck, »weniger schick als die Ausbeutung anderer«.
Auf seiner Internetseite zitiert Buschbeck zwei Slogans. »Bürger, zur Sonne, zur Freiheit«, heißt der eine; »Solarier aller Länder, vereinigt euch« der andere. Sie sind nur bedingt ironisch aufzufassen.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.