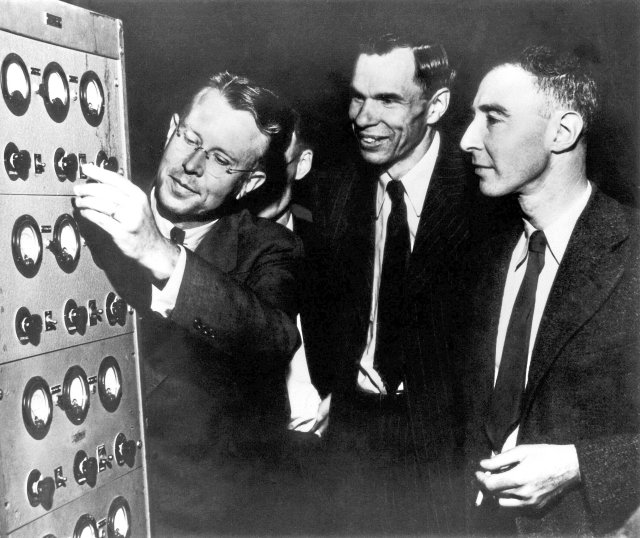Kriegsgegner und Gefühlssozialist
Der Physiker und Humanist Albert Einstein starb heute vor 50 Jahren
Mit Einstein, der 76 Jahre alt wurde, verlor die Welt nicht nur den brillantesten Physiker seit Isaac Newton. Sie verlor auch einen bewundernswerten Menschen, wie Thomas Mann in seinem Nachruf betonte, dessen moralische Haltung allem Konformismus weit überlegen war.
Schon im Oktober 1914, als 93 namhafte deutsche Künstler und Wissenschaftler öffentlich der Kriegspolitik Kaiser Wilhelms huldigten, unterzeichnete Einstein einen Aufruf gegen den Krieg und damit verbundene Kulturzerstörung. Zum politischen Aktivisten hingegen fühlte sich der Schweizer Staatsbürger Einstein seinerzeit nicht berufen. Er zog sich vielmehr in den Elfenbeinturm der Wissenschaft zurück und forschte mit fast übermenschlicher Energie nach den Feldgleichungen der Gravitation, die er 1916 erstmals der Öffentlichkeit vorstellte. Lediglich die Berliner Polizei warf während des Krieges hin und wieder ein waches Auge auf ihn - mit dem Ergebnis, dass sein Name 1918 auf einer Liste der 31 führenden Pazifisten und Sozialdemokraten auftauchte. Obwohl Einstein nie einer Partei angehörte, war er nach eigenem Bekunden ein »Gefühlssozialist« und begrüßte die Novemberrevolution ebenso wie das Ende der Monarchie.
Eine Räterepublik nach sowjetischem Vorbild lehnte er jedoch ab, zumindest für Deutschland. »Ich muss Dir übrigens berichten«, gestand er 1920 seinem Freund und Kollegen Max Born, »dass mir die Bolschewiken gar nicht so schlecht passen, so komisch ihre Theorien auch sind. Es wäre doch interessant, sich die Sache einmal aus der Nähe anzusehen.« Die Sowjetunion hat Einstein indes nie besucht, denn er fürchtete, dass man dies in Ost und West propagandistisch ausschlachten würde. Gleichwohl trat er 1923 der »Gesellschaft der Freunde des neuen Russland« bei und verehrte Lenin nach dessen Tod als »Hüter und Erneuerer des Gewissens der Menschheit«. In Deutschland unterstützte er die von der KPD ins Leben gerufene »Rote Hilfe« und hielt Vorträge an der Marxistischen Arbeiterschule in Berlin, unter anderem zum Thema »Was der Arbeiter von der Relativitätstheorie wissen muss«.
Hassobjekt der Rechten
Wenig angetan zeigte er sich von der politischen Entwicklung unter Stalin: »Oben persönlicher Kampf machthungriger Personen mit den verworfensten Mitteln aus rein egoistischen Motiven. Nach unten völlige Unterdrückung der Person und der Meinungsäußerung.« In den späten 40er Jahren geriet Einstein selbst ins Schussfeld stalinistischer Ideologen, die die Relativitätstheorie mit der Begründung ablehnten, sie sei undialektisch und mithin durch eine »materialistische Theorie schneller Bewegung« zu ersetzen. Sogar vom »reaktionären Einsteinianertum in der Physik« war 1952 in einer Zeitschrift die Rede, bevor die »anti-relativistische Walpurgisnacht« - so nannte der marxistische Historiker Friedrich Herneck dieses traurige Kapitel der sowjetischen Wissenschaftsgeschichte - langsam ihr Ende fand.
Einsteins linke Haltung blieb von solchen Ereignissen weitgehend unberührt. Seine Sympathien galten bis zuletzt den Unterdrückten und Verfolgten dieser Welt, für die Profiteure von Krieg und Ausbeutung hatte er hingegen nur Verachtung übrig. »Wer seinen Kopf aus dem Fenster steckt und dabei nicht sieht, dass die Zeit für den Sozialismus reif ist, der läuft wie ein Blinder durch dieses Jahrhundert.«
Als Einstein diese Zeilen niederschrieb, war er als »Bolschewistenfreund«, Jude und bekennender Pazifist längst zum bevorzugten Hassobjekt der extremen Rechten in Deutschland geworden. Aus dieser politischen Richtung kamen auch erste Versuche, an die Stelle der Relativitätstheorie, die ihrer vermeintlichen Unanschaulichkeit wegen zur »jüdischen Physik« erklärt wurde, eine »arische Physik« zu setzen. Initiator dieser Entwicklung war der Heidelberger Physiker Philipp Lenard, ein früher Parteigänger Hitlers, der 1922 in Stockholm vergeblich gegen die Verleihung des Physik-Nobelpreises an Einstein protestiert hatte. Im gleichen Jahr stand Einsteins Name ganz oben auf einer Liste prominenter jüdischer Persönlichkeiten, denen völkische Gruppen mit Mord drohten. Er zog sich daher vorübergehend aus Berlin zurück und spielte nach dem Attentat auf Außenminister Walther Rathenau sogar mit dem Gedanken, Deutschland für immer zu verlassen.
Doch erst nach der Machterschleichung der Nazis 1933 wurde dieser Schritt für ihn zur bitteren Notwendigkeit. Einstein übernahm eine Forschungsprofessor an der University of Princeton in den USA und lehnte es später kategorisch ab, noch einmal deutschen Boden zu betreten. Als Reaktion auf den wachsenden Terror der Nazis und die Verfolgung der Juden gab er bereits im Sommer 1933 seine pazifistische Haltung auf: »Gegen organisierte Macht gibt es nur organisierte Macht. Ich sehe kein anderes Mittel, so sehr ich es auch bedaure.« Zu den schmerzlichsten Erfahrungen seines Lebens gehörte sicherlich, dass viele seiner Kollegen und Freunde, darunter Max Planck und Werner Heisenberg, sich schon frühzeitig mit dem NS-Regime zu arrangieren versuchten.
Trotz allem fiel Einstein der Abschied von Deutschland und Europa nicht leicht. Obwohl er als Nobelpreisträger alle Vorzüge eines Prominenten genoss, fühlte er sich in den USA nie richtig heimisch. »In Wahrheit zählt hier nichts als das Geld«, teilte er 1937 seiner Schwester mit. Zwar seien die Amerikaner freier von Vorurteilen, »aber dafür meist hohl und uninteressant«. Resigniert gab er nach dem Zweiten Weltkrieg zu verstehen: »Ich habe einen Fehler gemacht, Amerika als das Land der Freiheit auszuwählen, einen Fehler, den ich in meinem Leben nicht mehr ausgleichen kann.«
Vor allem auf die wachsende Atomrüstung und Militarisierung der USA blickte Einstein mit Sorge. Denn dass Waffenhandel und Krieg für die Herrschenden nur Gelegenheiten seien, sich persönliche Vorteile und mehr Macht zu verschaffen, hatte er bereits 1932 in einem Briefwechsel mit Sigmund Freud betont, der unter dem Titel »Warum Krieg?« im Jahr von Hitlers Machtübernahme auch als Broschüre erschien. Nun ging Einstein noch einen Schritt weiter und fragte in einem 1949 in den USA veröffentlichten Aufsatz: »Warum Sozialismus?«
Seine Antwort: Weil die demokratische politische Organisation unserer Gesellschaft der Macht des Privatkapitals nicht gewachsen sei. Zudem führe das fortwährende Streben nach Profit »zu einer maßlosen Verschwendung von Arbeitskraft und zur Verkrüppelung der sozialen Seite in der Veranlagung der Individuen«. Nur wenn die Arbeitsmittel Eigentum der Gesellschaft und von dieser planwirtschaftlich verwendet würden, könnten die Menschen sich frei von Not und Arbeitslosigkeit entfalten. Dass die Errichtung einer Planwirtschaft immer auch die Gefahr der Versklavung des Individuums in sich birgt, verschwieg Einstein nicht. Aber, so fügte er hinzu: »Klarheit über die Ziele und Probleme des Sozialismus ist für unsere Zeit des Übergangs von größter Bedeutung.«
Angebot aus Israel
Obwohl er als mutmaßlicher kommunistischer Spion auf der Schwarzen Liste des FBI stand, erhielt Einstein im November 1952 ein überraschendes Angebot aus Tel Aviv. Ob er als Nachfolger des verstorbenen Chaim Weizmann nicht neuer Präsident des Staates Israel werden wolle, fragte ihn der israelische Premierminister David Ben-Gurion. Doch Einstein lehnte ab, nicht ohne zu bekennen, dass die Beziehung zum jüdischen Volk nach Auschwitz seine stärkste menschliche Bindung geworden sei. Seiner Stieftochter Margot wiederum vertraute er an, dass er dem israelischen Volk als Präsident durchaus ein paar unbequeme Wahrheiten gesagt hätte. Denn eines wurde Einstein nie müde zu betonen: Ohne Verständigung und Zusammenarbeit mit den Arabern hat der Staat Israel keine Zukunft.
Bis zuletzt warnte Einstein die Machthaber in West und Ost vor der drohenden Selbstvernichtung der Menschheit, die unausweichlich sei, wenn die Institution des Krieges nicht bald abgeschafft werde. Doch er blieb ein Rufer in der Wüste, der sich eingedenk des atomaren Wettrüstens und des McCarthyismus in den USA einmal zu der sarkastischen Bemerkung hinreißen ließ: »Menschen sind wie Flugsand, und man ist nie sicher, was morgen oben liegt.«
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser:innen und Autor:innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.