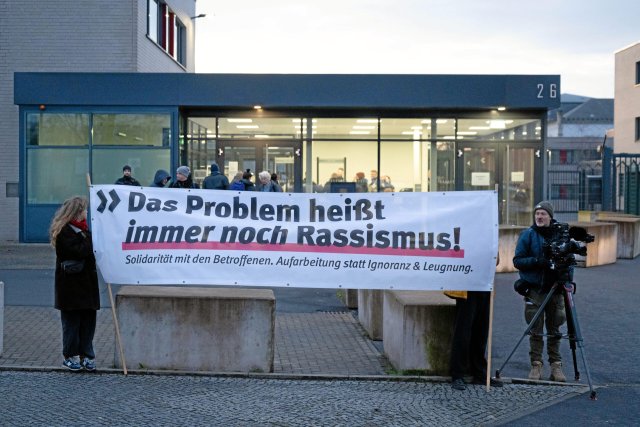- Politik
- Götz Friedrich inszenierte Wagners Parsifal in der Deutschen Oper
»Zum Raum wird hier die Zeit«
Gösta Winbergh als Parsifal
Foto: Benjamin
Während die szenisch-musikalische Wagner-Erneuerung in der Berliner Linden-Oper jetzt mit den »Meistersingern von Nürnberg« ihre Fortsetzung erreichte, brachte Götz Friedrich, der Hausherr der Deutschen Oper, nun seine Berliner Wagner-Interpretationen mit dem »Parsifal« zum (vorläufigen?) Abschluß.
Dieses letzte Bühnenwerk Wagners ist als dramatisch-philosophisches, theatralisches Endspiel dem ausgehenden 19 Jahrhundert ebenso verbunden wie der Reflexion über Zukünftiges. »Zum Raum wird hier die Zeit« heißt es da in kühnem Vorgriff auf Albert Einsteins berühmte Formel. In den mythischen Stoff um die Ritter des heiligen Grals schlingen sich die Fäden aus Wagners früheren Werken, gemischt mit Mixturen aus fernöstlichen Kulturen. Die Erlösungsidee, nur noch vage mit christlichen Vorstellungen verbunden, zeigt eine ritterlich-martialische Gemeinschaft am Ende. Ein Ritus, die Enthüllung des Grals, hält sie am Leben. Amfortas, der verwundete Gralskönig, wird durch seine Gesellen immer wieder gezwungen, unter zunehmenden
Schmerzen, den Ritus durchzuführen. Parsifal, »den reinen Tor«, führt der alte Gurnemanz belehrend in die Gemeinschaft ein. Aber der bleibt vor dem weihevollen, Spektakel, das er nicht begreift, scheu und stumm. So weist ihn Gurnemanz aus dem heiligen Kreise. Wissen und Verstehen erwirbt sich Parsifal erst auf anschließender Irrfahrt durch die Menschenwelt. Dabei wächst ihm aus Erkenntnis das Wissen um das Mitleid als weltverändernde Einsicht zu. Er gewinnt den Speer zurück, den Amfortas einst am gleichen Ort verlor Und so kann er endlich die inzwischen vollends erstarrte Gralsgesellschaft erlösen: Eben durch Mitleid, durch eine »friedliche Revolution«. - »Als ob wir Kindheitsträume durch alle Katastrophen mit uns in die Zukunft nehmen«, bermerkt dazu Götz Friedrich im Programmheft der neuen Inszenierung.
Der »Parsifak-erfahrene Regisseur setzte das Spiel hier in einen sterilschlichten, gleichsam graphisch konzipierten »zeitlosen« Bühnenraum (Andreas Reinhardt), dem Farben und wenig Interieur Akzente geben. Kühle Saal-Atmosphäre wird vermittelt. Die Aktionen auf der Bühne verlaufen im Gleichklang zur Musik, langsam, immer in der Nähe
zum Statischen. Die Zauberwelt Klingsors im zweiten Akt mit den Blumenmädchen und Kundry geht, wie heute offenbar üblich, von Wagners Hinweis aus, die Szene möge hier »amerikanisch sein wollen«. Klingsor mit Bildschirm und Mikrophon also, seine Blumenmädchen im geklonten Glitzeroutfit, Weltkugel und Sternenkugel als Spielzeug. Die Rückkehr zu den Gralsrittern führt letztlich in eine heruntergekommene Gralswelt.
Freilich gerät die spielerische Statik im Ganzen auf der Bühne zu in Bewegung und Gestik gehemmter, gleichsam unpersönlicher Aktion, die alles Charakteristische, Emotionale der Musik und der Initiative der Darsteller überläßt. Die »sachliche« Szenerie setzt sich in den »neutralen« Aktionen der Sänger fort. Das stört zuweilen erheblich. Hinzu kommt, daß das Orchester der Deutschen Oper unter seinem jungen Chef Christian Thielemann zwar erfreulich genau musiziert und akzentuiert, dies aber unter ständiger (leider auch dynamischer) Hochspannung und betonter Schärfe tut: Die Klangnuancen werden so kaum hörbar Violeta Urmana war eine prächtige Kundry, stimmlich für diese komplizierte Partie wie geschaffen. Matti Salminen (Gurnemanz) lieferte den Glanzpunkt die-
ser Inszenierung: Mit seinem kultiviert geführten, voluminösen Baß, in menschlich berührender Bühnenerscheinung. Amfortas (Philippe Rouillon), Klingsor (Lenus Carlson), vor allem auch der Parsifal dieser Inszenierung, Gösta Win-
bergh, fügten sich überzeugend ins Ensemble. Es gab viel Beifall für den Gesang. Friedrichs Regie jedoch provozierte beträchtlichen Protest, aber auch Thielemanns Dirigat blieb hier nicht unwidersprochen.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.