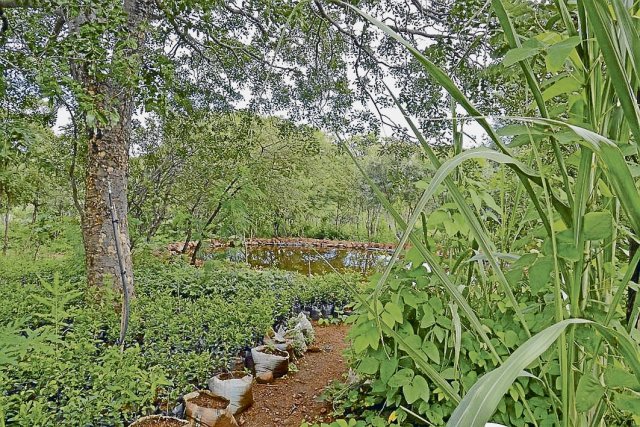- Politik
- Vor 60 Jahren starb Carl von Ossietzky - noch immer nicht juristisch rehabilitiert
Tod im »Zauberberg der Armen«
Von Jochen Reinert
Das stattliche Parkgrundstück Mittelstraße 6-8 in Berlin-Niederschönhausen liegt einsam und verlassen. Vor 60 Jahren spielte sich hier eine bittere Episode deutscher Geschichte ab: Friedensnobelpreisträger Carl von Ossietzky, von 1933 bis 1936 in den KZ Sonnenburg und Esterwegen gepeinigt, starb in dem damals auf diesem Grundstück gelegenen und später ausgebombten Sanatorium Nordend einen langsamen Tod. Er litt an Tuberkulose, KZ-Mitgefangene gaben später zu Protokoll, ihm seien Tuberkelbazillen injiziert worden. Sanatoriumsleiter Dr Wilhelm Dosquet half dem schwerkranken Nazigegner so gut er konnte - obwohl er als Jude selbst mit größten Schwierigkeiten rechnen mußte.
»Mein Vater hat Dr Dosquet schon vor seiner Verhaftung gekannt oder wußte zumindest von ihm«, berichtet Rosalinda von Ossietzky-Palm, die in Stockholm lebende Tochter des einstigen »Weltbühnen«-Chefs. Nachdem die Nazis den Pa-
zifisten, der von einer internationalen Kampagne für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen wurde, kurz vor den Berliner Olympischen Spielen 1936 aus dem KZ holten, habe er ausdrücklich um Aufnahme in das Sanatorium Nordend gebeten. Nach Aufenthalten in anderen Berliner Krankenhäusern wurde er dort im Dezember 1936 eingeliefert. »Mein Vater hatte großes Vertrauen zu dem als Armenarzt bekannten Mediziner«, weiß sie aus Berichten ihrer Mutter Maud von Ossietzky, die 17 Monate lang das Krankenzimmer mit ihrem Mann teilte. Weihnachten 1937 schrieb Ossietzky an Dosquet: »Ich glaubte zunächst, einen guten Arzt gefunden zu haben, der seine Sache versteht, und statt dessen habe ich einen sorgenden Freund gefunden, dessen gütige Menschlichkeit sich zwischen mich und die Krise stellt«.
Dr Dosquet, so notiert die Berliner Historikerin Dr Inge Lammel in der verdienstvollen Dokumentation »Jüdisches Leben in Pankow«, hatte neue Heilmethoden für chronische und akute Krankheiten mit Hilfe von Sonne, Licht und bewegter Luft erforscht. Er hat auch einen neuen Krankenhaustyp entwickelt, flache
Pavillons, deren große Glasvorderfronten nach oben geschoben werden konnten. Offenbar waren auch Carl und Maud von Ossietzky in einem solchen »Dosquet-Zimmer« untergebracht.
Jene Zimmer waren indes laut einem Augenzeugenbericht der jungen norwegischen Pazifisten Finn und Inger Lie, die im April 1938 den Weg zum Sanatorium fanden - Ossietzky war schon längere Zeit bettlägrig, und die sonst strenge Polizeiüberwachung wurde laxer gehandhabt -, sehr ärmlich ausgestattet. Auch die medizinische Behandlung hielt sich in Grenzen. Wenn Ossietzky je auf Genesung in einem besseren Sanatorium gehofft hatte, so zerschlug sich dies, als ein gewisser Dr Warnow den größten Teil des Nobelpreisgeldes veruntreute. So blieb Ossietzky im »Zauberberg der Armen«, wie Dr. Dosquet jun., der nach dem Tode seines Vaters im Januar 1938 die Behandlung fortsetzte, das Sanatorium gegenüber den jungen Norwegern bezeichnete.
Die damals 18jährige Ossietzky-Tochter Rosalinda lebte in jenen Tagen in einem schwedischen Internat. Im Januar 1938 hatten sie noch die Neujahrswünsche ihres Vaters erreicht, innige Zeilen mit vielen guten Ratschlägen: »Dein wirk-
liches Kapital sehe ich in Deiner Sprachbegabung, da ist wirklich etwas, worauf Du Deine Zukunft stellen kannst .« Der Tod ihres Vaters kam wie ein Schock
In all den Jahren nach Ende des Zweiten Weltkrieges hat Rosalinda von Ossietzky von Stockholm aus genau verfolgt, wie die Deutschen mit dem Erbe ihres Vaters umgehen. Und nach der Wende hatte sie gehofft, ihrem Vater werde endlich auch juristische Rehabilitierung zuteil. Das Leipziger Reichsgericht hatte ihn 1931 als »Landesverräter« verurteilt, und unter anderem mit diesem Argument war er noch in der Nacht des Reichstagsbrandes von den Nazis verhaftet worden. Doch Frau von Ossietzky wurde bitter enttäuscht. Obwohl sie bei ihrem Begehren um Wiederaufnahme jenes Prozesses von einer Reihe namhafter Juristen wie Heinrich Hannover, Ingo Müller und Ekkart Rottka tatkräftig unterstützt wurde, wies die bundesdeutsche Justiz dies kaltherzig ab.
Frau von Ossietzky schöpfte erneut Hoffnung, als der SPD-Rechtsexperte Prof. Dr Jürgen Meyer Anfang 1996 einen Gesetzesentwurf für die Reform des äußerst restriktiven deutschen Wieder-
aufnahmerechtes in den Bundestag einbrachte, der auch die Chance für eine Rehabilitierung des Friedensnobelpreisträgers eröffnet hätte. Aber - vor sechs Wochen ist dieses Projekt im Rechtsausschuß des Bundestages gescheitert. Prof. Meyer gab sich jedoch gegenüber ND optimistisch, daß die Reform dennoch gelänge. Einen Teil der angestrebten Reform - die Einführung des Wiederaufnahmegrundes »Konventionswidrigkeit« (sprich: Verletzung der europäischen Menschenrechtskonvention) - konnte er indes durchsetzen. Die anderen acht Teile seines ursprünglichen Entwurfes will er im nächsten Bundestag neu einbringen, bei dessen Wahl im September er sich neue Mehrheiten erhofft. Gerade jener Passus, der Ossietzky beträfe, sei auch von den Grünen gebilligt worden. Die CDU habe abgelehnt, leider hätten auch die Liberalen kein Verständnis gezeigt. Die Frage, ob am Ende doch noch eine juristische Rehabilitierung Ossietzkys vor einem deutschen Gericht stattfinden könne, beantwortete Meyer mit einem Ja. »Wenn dies weiter mit Versuchen nach geltendem Recht scheitern sollte, dann ich habe ja nun auch genügend Hartnäkkigkeit bewiesen - mache ich das mit meinem Entwurf«, gibt er selbstbewußt zu verstehen.
Rosalinda von Ossietzky hört die Botschaftwohl, und ihr fehlt der Glaube nicht vollends. Aber sie meint auch: »Die Rehabilitierung muß bald geschehen, nicht erst im nächsten Jahrtausend«.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.