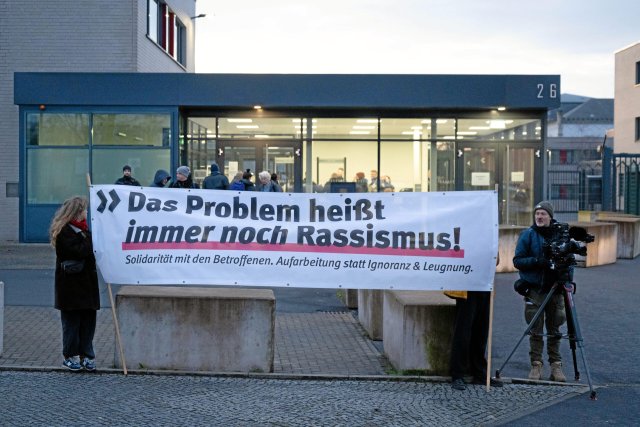Verhältnis von Pachtrecht und Vereinsrecht
in einem Kleingartenverein gebunden ist.
Tatsächlich wird das Kleingartenwesen jedoch wesentlich über die Mitgliedschaft in einem Kleingartenverein organisiert. Diese Praxis ist historisch gewachsen und hat sich bewährt. Zur Beibehaltung dieser Praxis verpachten die meisten als Zwischenpächter fungierenden Kleingärtnerorganisationen Kleingärten nur an solche Personen, die vorher die Mitgliedschaft im betreffenden Kleingartenverein erlangt haben. Das ist rechtlich zulässig. Damit wird gewährleistet, daß nur an Vereinsmitglieder Kleingärten verpachtet werden, die dann an Satzung und Beschlüsse des Vereins zur Organisierung des Kleingartenwesens im betreffenden Bereich gebunden sind.
Wird die Mitgliedschaft im Verein durch Ausschluß oder Austritt des Mitgliedes beendet, bedeutet dies jedoch nicht die Beendigung des
Pachtverhältnisses. Das Nichtmitglied des Vereins bleibt Pächter des Kleingartens. Sollten die Gründe, die zum Ausschluß aus dem Verein geführt haben, auch Kündigungsgründe des § 8 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 BKIeingG sein, so muß neben dem Ausschluß aus dem Verein auch die Kündigung des Pachtverhältnisses ausgesprochen und erforderlichenfalls auf dem dafür vorgesehenen Rechtsweg durchgesetzt werden.
Mit Beendigung der Mitgliedschaft im Verein ist der jeweilige Kleingartenpächter nicht mehr an die Satzung und Beschlüsse des Vereins gebunden. Er muß auch keinen Mitgliedsbeitrag mehr bezahlen. Allerdings erfolgt die Verwaltung der Kleingartenanlagen und einzelner Kleingärten im Kleingartenwesen herkömmlicherweise über den Verein, der sich aus Mitgliedsbeiträgen finanziert. Fällt dieser Mitgliedsbeitrag weg, muß der nicht dem Verein an-
gehörende Kleingärtner zusätzlich zum Pachtzins mit einer Verwaltungsgebühr rechnen. Der betroffene Kleingärtner muß sich auch weiterhin bzgl. der entstehenden Allgemeinkosten für die Kleingartenanlage (z. B. Instandhaltung der äußeren Umzäunung, der Parkplätze u. a. m.) sowie an der Erhaltung der Elektroenergie- und Wasserversorgungsanlagen beteiligen, weil er das vorher auch als Vereinsmitglied getan hat.
Allerdings gelten für ihn dann auch nicht mehr die vereinsrechtlichen Regelungen, sondern die Regelungen des BGB über die Gesellschaft. Treten diesbezüglich Probleme auf, sollten diese schriftlich in einem Vertrag zwischen dem Kleingärtner und dem Verein bzw. dem Zwischenpächter geregelt werden. Jedenfalls ist die Beendigung der Mitgliedschaft im Verein kein Grund und keine Möglichkeit für den Kleingartenpächter, sich solchen
Verpflichtungen zu entziehen, die allein mit der Nutzung des Kleingartens zusammenhängen.
Abschließend sei noch angemerkt, daß noch eine Reihe von Kleingärtnern über ein schriftliches Vertragswerk in Form des ehemaligen VKSK-Nutzungsvertrages verfügen. Darin ist das Pachtverhältnis immer noch an die Mitgliedschaft im VKSK geknüpft. Aus dem vorgenannten und einer Reihe weiterer Gründe ist es jedoch zweckmäßig, diese alten schriftlichen Vertragswerke durch neue Verträge mit dem als Zwischenpächter fungierenden Kreis-, Bezirks- oder Regionalverband zu ersetzen. Das schafft Rechtssicherheit.
Der Abschluß neuer Kleingartenpachtverträge ist nicht - wie oft vermutet - mit einem Rechtsverlust für die Kleingärtner verbunden. Im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung gibt es mit den Altpachtverträgen nur eine Reihe zusätzlicher Probleme. Allerdings sollten die Altpachtverträge zum Zwecke einer eventuell erforderlichen Beweisführung beim Vereinsvorstand zugriffsbereit archiviert werden.
Dr. UWE KÄRRSTEN, Rechtsanwalt
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.