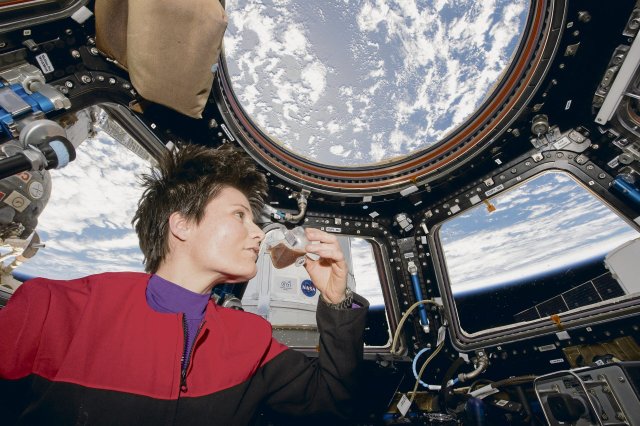Eine Schule, die gut für Lehrer ist
An der Berliner Peter-Petersen-Grundschule werden Schüler zu Lehrern
Wochenplanarbeit steht heute auf dem Programm. Die Sechs- bis Achtjährigen holen sich ihre kleinen Holzkästen aus dem Regal und beenden heute das, was sie zu Beginn der Woche angefangen haben: Rechenaufgaben zum Beispiel oder ein Diktat, andere sind mit einer Bastelei beschäftigt.
Stammgruppen statt Schulklassen
Die Regeln dieses Lernprozesses sind einfach - und wirksam. »1. Rede leise; 2. Lege fertige Arbeiten gleich ins Körbchen, ohne sie der Lehrerin zu zeigen; 3. Denke selber nach, Frage ein Kind, Frage noch ein Kind, Frage einen Erwachsenen«. So stehen die Regeln für den Unterrichtsalltag an der Wand. Benannt ist die Schule nach dem Reformpädagogen Peter Petersen, der schon in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts in Jena seine Idee von einer Schule für alle in die Praxis umgesetzt hatte. Eine Schule, die den Schülern nicht nur Wissen vermittelt, sondern das Zusammenleben praktizieren will, schwebte Petersen vor. Im Zuge der Reformdebatte nach dem deutschen PISA-Desaster ist Petersens Lernideal wieder in Mode gekommen.
Die Schule in Neukölln ist bislang die einzige in Berlin, die sich voll und ganz dem so genannten Jenaplan verschrieben hat. Kernprinzip des Schulmodells ist es, die Grundformen des Miteinander-Lernens und -Lebens nach Petersen, nämlich: Gespräch, Spiel, Arbeit und Feier zur Grundlage des Stundenplans zu machen, und zwar in altersgemischten Stammgruppen, die jeweils drei Jahrgangsstufen umfassen. Sitzenbleiben gibt es nicht mehr, die Kinder bleiben drei, manche aber auch vier oder nur zwei Jahre in ihrer Gruppe - je nach Leistungsstärke. Sechsjährige Mathe-Asse lernen auf dem Niveau von Klasse Drei, in Deutsch aber üben sie noch als Erstklässler das Lesen und Schreiben.
»Denke selber nach, frage ein Kind, frage noch ein Kind, frage einen Erwachsenen.«
In der Stammgruppe 1.2, also bei den Kleinen bis zur dritten Klasse, unterrichtet Frau Andermann. »Hier fällt ja gar nicht auf, wer in der ersten und wer in der dritten Klasse ist«, meint der Lehrer neben mir. Wie seine Sitznachbarin gehört er zu einer Gruppe von Lehrern aus dem Bezirk Treptow/Köpenick, die heute zu Besuch sind, um die Lernmethoden ihrer Neuköllner Kollegen zu studieren.
In der Tat wird der Unterschied zwischen einzelnen Schülern erst auf den zweiten Blick deutlich. So zum Beispiel bei Anton*. Der Siebenjährige ist hochbegabt. Als die Hospitanten das Zimmer betreten, bietet er sich eilfertig an, den »Neuen« Stühle zu holen, ihnen alles zu erklären. Er sei schon in der dritten Klasse, erzählt Anton stolz. Weil sein Wissensdurst von der Schule allein nicht gestillt werden kann, besucht Anton am Wochenende einen Kurs für Hochbegabte. Davon profitieren auch seine Mitschüler. In der Stuhlrunde, die am Freitagnachmittag die Woche abschließt, liest er aus seinem Geschichtenheft vor, was er am vergangenen Wochenende gemacht hat. »Am Sonntag haben wir ein Wärmekissen hergestellt. Dafür benötigt man Eisen, Salz, Aktivkohle und Wasser. Das ist praktisch, weil man dann keine Wärmflasche braucht.«
Nachdem Anton seine Geschichte beendet hat, fragt Ute Andermann die anderen Schüler, was man für ein Wärmekissen brauche. Die Finger schnellen hoch. Doch längst nicht alle sind bei der Sache, einige wirken abwesend und können, als sie selbst mit dem Geschichtenerzählen an der Reihe sind, nur schwerlich ihre Unlust verbergen. Aber immerhin: das fällt wenigstens auf. In vielen Schulen ist die Realität eine andere: ein Drittel der Schüler macht mit, das zweite hört noch zu, das letzte Drittel aber ist nur körperlich anwesend. Das Schlimme ist, dass beim immer noch dominierenden Frontalunterricht dieser Missstand von den Lehrern gar nicht wahrgenommen werden kann. Wenn einer immer nur erzählt, hat er keinen Blick für jene, die sich innerlich schon von der Schule verabschiedet haben.
Neben Anton sitzt August. Die beiden wirken wie Kumpels, aber: »August ist ein Problemfall«, seufzt Ute Andermann. »Bleibt er ohne Aufsicht, quält und schlägt er andere Kinder, scheinbar grundlos, aber mit brutaler Gewalt«. Die Aggression des Siebenjährigen kann sich niemand so recht erklären, auch die Eltern nicht, mit denen es regelmäßig intensive Gespräche gebe, meint die 40-jährige Pädagogin. Seit fünf Jahren ist sie an der Neuköllner Schule. Mit alters- und leistungsgemischten Gruppen hat sie allerdings schon drei Jahre länger Erfahrung. Eine Erfahrung, die sie nicht missen möchte. Wunder könne allerdings auch der Jenaplan nicht bewirken, schränkt Ute Andermann ein. »Die soziale Realität können wir nicht ändern«. Vier bis sechs Stunden in der Woche ist sie mit Tätigkeiten beschäftigt, die eigentlich Aufgabe von Sozialarbeitern ist - Kinder von zu Hause abholen, weil sie von den Eltern nicht in die Schule geschickt werden, zum Beispiel. »Manchmal möchte man schon verzweifeln, wenn man sieht, dass nur wir uns an die gemeinsam mit den Eltern aufgestellten Förderpläne halten, die Eltern aber nicht.«
Wer gut lernen soll, braucht Lob
Vieles wäre vielleicht besser, stimmten die Rahmenbedingungen. Aber die sind auch an der Peter-Petersen-Grundschule alles andere als optimal. Ute Andermann muss heute alleine unterrichten. Nur zu Beginn assistiert ihre eine Kollegin aus der höheren Stammgruppe (4. bis 6. Klasse), die etatmäßige Kollegin ist krank. Eine Klasse mit 29 Kindern ist auch an einer Jenaplan-Schule kein Pappenstiel, individuelle Förderung stößt so schnell an Grenzen. Zumal die räumlichen Bedingungen für die derzeit 380 Schüler zu eng sind, wie Schulleiterin Ruth Weber kritisiert.
Das wichtigste Bildungsprinzip soll dennoch nicht zu kurz kommen. An der Jenaplan-Schule steht die Anerkennungskultur ganz oben auf der Werteskala. Vielleicht ist das das ganze Geheimnis jeglicher guten Pädagogik: Kinder wertzuschätzen, ihnen etwas zutrauen, sie loben. Anstatt: sie ständig kritisieren, ihre Defizite betonen, sie zu demütigen. »Das hast du gut gemacht« klingt in Kinderohren allenthalben besser als »Das kannst Du aber besser«.
Anerkennungskultur kann sich vielfältig äußern. Ruth Weber berichtet von zwei, eigentlich ganz unterschiedlichen Begebenheiten der jüngsten Zeit. Ein aus Litauen stammender Schüler hatte den Sprung aufs Gymnasium geschafft. »Am Schuljahresende wurde der Schüler mit Standing Ovations verabschiedet.« Ein andermal schrieb eine Schülerin, »die in Englisch ganz schlecht ist«, im Vokabeltest eine Eins. »Mitschüler klopften ihr auf dem Pausenhof anerkennend auf die Schulter.«
Lernen aber ist mehr als nur das Anhäufen von schulischem Wissen. Wer in Mathe vielleicht nicht so gut ist, hat auf anderen Gebieten seine Stärken. »Da trägt schon mal der hippe Zwölfjährige die Sechsjährige, die im Pausenhof hingefallen ist, liebevoll zum Verarzten in die Schule. Das ist akzeptiert, da wird keiner als "uncool" gehänselt«, erzählt Hildegard Greif-Groß. Konrektorin der Peter-Petersen-Schule.
Vom guten Klima profitieren aber auch die Lehrer. »Oft tendiert man aus reiner Gewohnheit dazu, sich mehr Homogenität in einer Lerngruppe zu wünschen. Als wir das in Englisch einmal gemacht haben, war der Englisch-Lehrer aber der erste, der aufgeschrien hat«, berichtet Hildegard Greif-Groß. Welcher Lehrer unterrichte schon gern eine Gruppe leistungsschwacher Englisch-Schüler. »Das demotiviert nicht nur Schüler, sondern auch Lehrer«, betont die Pädagogin.
Die profitieren an der Jenaplan-Schule noch in anderer Hinsicht von den auf Vielfalt ausgerichteten Lerngruppen. Eingeführte Regeln müssen nie mehr neu eingeübt werden. »Statt 29 Schulanfänger haben wir in der Gruppe eben nur 10 "Erstklässler". Die "Großen" zeigen den "Kleinen" zum Beispiel den Weg zum Klo.« Das hilft den Schülern - und entlastet die Lehrer.
Dennoch: Auch an der Jenaplan-Schule hat die heile Welt ihre unschönen Seiten. Jahrzehntelang hat sich die deutsche Mehrheitsgesellschaft geweigert, Migration als Teil ihres Alltags zu respektieren, jetzt rächt es sich, dass Ausländer in den 60er und 70er Jahren nur als Gastarbeiter gesehen wurden, die irgendwann wieder verschwinden werden. Das Problem ist bekannt und wissenschaftlich hinreichend beschrieben. Viele seiner Landsleute seien nach Berlin gekommen, ohne jemals eine größere Stadt in der Türkei überhaupt nur gesehen zu haben, umschrieb ein junger Berliner Student aus Istanbul kürzlich das Problem der anatolischen Zuwanderung nach Deutschland.
Gummibärchen und Schweinefleisch
Im Berliner Bezirk Neukölln, wo an manchen Schulen über 90 Prozent der Schüler nichtdeutscher Herkunft sind, kommt man in der Schulpraxis mit dieser soziologischen Erkenntnis jedoch nicht weiter. Es gibt Schüler, die sich weigern, beim gemeinsamen Mahl mitzuessen, weil sie befürchten, im Essen könnte etwas sein, was sich nicht mit ihrem muslimischen Glauben vereinbaren lässt, meint Ruth Weber. Sie erzählt, dass sie von manchen Vätern von Schülern beim Gespräch nicht angeschaut werde. Und sie berichtet von der Hilflosigkeit von Kolleginnen, die sich von jungen türkischen Machos als Frau nicht respektiert fühlen. Einen Königsweg, der einen Ausweg aus diesem Kulturkampf weisen könnte, kennt auch Frau Weber nicht. »Man muss gerade als Frau selbstbewusst auftreten«, betont sie. Vätern, die sie nicht anblicken, sagt sie ins Gesicht, dass sie sie anschauen sollen, wenn sie mit ihr reden.
Psychischer Selbstschutz tut Not, wenn Gesellschaft und Politik versagt haben. Sie habe die Erfahrung gemacht, dass manche der türkischen und arabischen Eltern gar nicht kompromissbereit seien, klagt Ruth Weber. »Wenn man Ausnahmen vom gemeinsamen Schwimmunterricht von Mädchen und Jungen zulässt, werden die Forderungen nach oben geschraubt.« Als nächstes werde verlangt, dass in den Gummibärchen, die im Osternest liegen, keine Bestandteile vom Schwein sind. Es sei daher wichtig, klare Regeln vorzugeben, auch wenn das möglicherweise dazu führe, dass Muslime die Peter-Petersen-Schule bewusst meiden. Der »Ausländer«-Anteil an Ruth Webers Schule ist deshalb vergleichsweise gering. Zur Zeit sind 51 Prozent der Schüler nicht-deutscher Herkunft. Die meisten davon aus laizistisch orientierten Familien, vermutet die Schulleiterin. Diese suchten sich die Schule ganz bewusst aus, weil sie die Integration ihrer Kinder wollten.
* Namen der Schüler von der Redaktion geändert.
Weitere Infos:
www.pps.cidsnet.de
www.jenaplan.de.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.