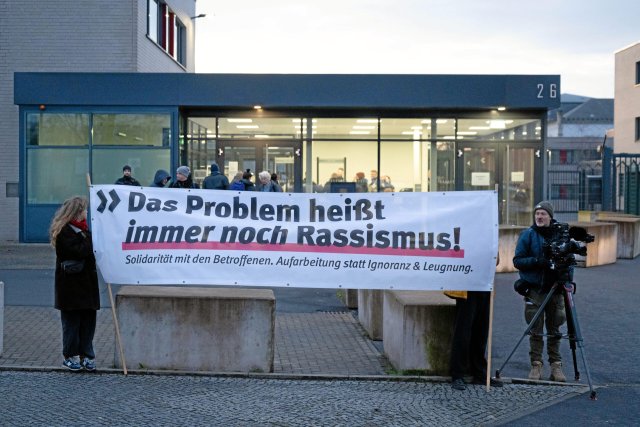Im Pantheon des indischen Freiheitskampfes
Vor 60 Jahren kam Subhas Chandra Bose ums Leben. Ein Monumentalfilm aus Bollywood und Spuren im sachsen-anhaltischen Annaburg
Dies sind die ersten Szenen des unlängst in Indien uraufgeführten Films »Netaji - the Forgotten Hero« (Netaji - der vergessene Held) über die letzten fünf Lebensjahre des lange umstrittenen Politikers, der spätestens an seinem 100. Geburtstag 1997 neben Mahatma Gandhi und Jawaharlal Nehru in den Pantheon der drei bedeutendsten Führer des indischen Freiheitskampfes aufgenommenen wurde.
Abenteuerliche Flucht via Kabul nach Berlin
»Shyam Benegals Film hat mir sehr gut gefallen, denn ich habe viel Neues über Bose erfahren«, berichtet der in Berlin lebende indische Geschäftsmann Vijay Hotani, der eine der ersten Aufführungen des fast vierstündigen Monumentalfilms in Delhi sehen konnte. Zu diesen wenig bekannten Vorgängen rechnet Hotani nicht zuletzt die schwierigen Verhandlungen, die der Flüchtling mit den Kabuler Botschaftern der Sowjetunion, Italiens und Deutschlands führte.
Bose, 1938 und 1939 Präsident der Kongresspartei, hatte sich mit Gandhi und Nehru über den Kurs zur Befreiung Indiens von der britischen Kolonialherrschaft zerstritten. Während die beiden auf den gewaltlosen Widerstand setzten, wollte er sein Land möglichst schnell von seinem Joch befreien und suchte nun Unterstützer. Doch Moskau fürchtete eine britische Provokation, schließlich gelangte der Inder mit einem italienischen Pass am 3. April 1941 nach Berlin - was die Briten zu verhindern trachteten. Wie jetzt in Kalkutta bekannt wurde, sollten Agenten des Geheimdienstes Special Operations Executive (SOE) Bose »liquidieren«.
Shyam Benegal, einer der profiliertesten indischen Regisseure, wollte sein Epos möglichst an Originalschauplätzen drehen, und so kam er im Sommer 2003 auch für einige Wochen nach Berlin. Benegal war bereits mit einem Film (über Gandhi) und einer TV-Serie (über Nehru) zum Thema indischer Befreiungskampf hervorgetreten. An dem Bose-Stoff, so sagte er mir, reizten ihn nicht zuletzt die Kontroversen über dessen Pakt mit den faschistischen Achsenmächten. Bose sei nach Berlin gegangen, weil er glaubte, beim Feind seines Feindes eine Exilregierung bilden zu können, um auf gleicher Augenhöhe mit ihm verhandeln zu können.
Kein Wunder, dass Vijay Hotani im Delhier Filmtheater besonders jene Szenen verfolgte, in denen Bose in Berlin für seine Pläne warb - aber schließlich nur Teilerfolge wie die Einrichtung eines Free India Center (Zentrale Freies Indien) erreichte. Lediglich die Bildung einer Indischen Legion und des Rundfunksenders »Azad Hind« kam seinen Vorstellungen nahe. Spannend war für Hotani, dass Bose in Adam von Trott zu Solz, einem der Verschwörer des 20. Juli, einen Förderer fand, der die indischen Nationalisten vor einem allzu starken Zugriff der Nazis zu bewahren suchte.
Die Indische Legion, deren Wiege im sachsen-anhaltischen Annaburg stand, kommt im Film allerdings nur am Rande ins Bild, fiel Hotani auf. Zumal er selbst das Städtchen 100 Kilometer südlich von Berlin vor einiger Zeit besucht hatte, um sich nach Zeugnissen jener Tage umzusehen - und dort weit mehr fand, als er gedacht hatte. Denn in den letzten Jahren ist hier viel geschehen. Nachdem der Leipziger Historiker Gerhard Selter im Zuge seiner 1965 bei Prof. Walter Markov verteidigten Dissertation »Die Indienpolitik des faschistischen Deutschland im Zweiten Weltkrieg« erste Untersuchungen in Annaburg anstellte, grub der Hobbyforscher Volker Kummer in den 90er Jahren zahlreiche Dokumente und Fotos aus, die heute im Stadtmuseum zu sehen sind.
»Mitten in Annaburg«, so erfährt der Besucher von der rührigen Bibliotheks- und Museumschefin Waltraud Meißner, »gab es damals das größte Lager indischer Kriegsgefangener in Europa. Vom Sommer 1941 bis 1945 kamen fast 4000 Inder hierher, die sich im Ort praktisch frei bewegen konnten.« Unmittelbar neben dem in kräftigem Ocker strahlenden Renaissance-Schloss aus dem Jahre 1575 waren mehrere große Baracken für die Gefangenen errichtet worden, weiß Frau Meißner zu berichten. Heute dehnt sich hier bis hinüber zur Sekundarschule eine grüne Wiese. Doch auf der anderen Seite der Schlossstraße ist das riesige ziegelrote Hauptgebäude des ehemaligen Lagers, eine frühere kaiserliche Unteroffiziersschule, noch erhalten - wenn auch in erbärmlichem Zustand. Nach dem Abzug der Sowjetarmee 1992 stand es viele Jahre lang leer, jetzt endlich sind die ersten Baugerüste zu sehen. Das Rote Kreuz will hier ein Altenheim einrichten, so die Bibliothekschefin.
Dank aus Kalkutta für Annaburger Forschung
Viele Inder arbeiteten auf freiwilliger Basis in verschiedenen privaten Handwerks- und Landwirtschaftsbetrieben rings um Annaburg. Es gab mancherlei persönliche Kontakte, wovon auch die Geburt von fünf indisch-deutschen Kindern zeugt. Am längsten währten die Verbindungen zwischen dem Gefangenen Subhas Sohan Singh und der Bauernfamilie Kossagk, die auf einer der Schautafeln im Stadtmuseum dokumentiert sind.
Die indischen Kriegsgefangenen wurden in Annaburg zusammengeführt, um Bose - er wurde von seinen Anhängern jetzt achtungsvoll »Netaji« (Führer) genannt - die Werbung für die Indische Legion zu erleichtern. Bose selbst kam am 21. Dezember 1941 zum ersten Mal nach Annaburg. Schließlich schlossen sich rund 3500 der insgesamt 15 000 indischen Kriegsgefangenen der Legion an. Sie wurden fortan in Königsbrück ausgebildet. Die Legion war als Keimzelle für eine künftige Befreiungsstreitmacht gedacht. Anders als in der britisch-indischen Armee üblich, hob Bose die Trennung in Volks-, Religions- und Kastengruppen auf. Die ursprüngliche Idee, die Kämpfer via Sowjetunion gegen die britische Kolonialmacht zu führen, ließ sich freilich nicht verwirklichen. Die Legion wurde schließlich zur Küstenverteidigung in Frankreich eingesetzt, das Gros geriet in Süddeutschland in alliierte Gefangenschaft.
»Die Besucher Annaburgs«, freut sich Waltraud Meißner, »sind immer wieder erstaunt über diesen weithin unbekannten Teil unserer Stadtgeschichte und wollen möglichst viel darüber wissen«. Deshalb soll die Ausstellung im Stadtmuseum unter anderem durch Originalgegenstände aus dem Lager erweitert werden. Inzwischen ist übrigens auch das Netaji Research Bureau in Kalkutta in den Genuss der im Annaburger Verein für Heimatgeschichte und Denkmalpflege e.V. betriebenen Forschungen gekommen. Das Museum zeigt einen Brief, in dem Netaji-Neffe Sisir Kumar Bose den Annaburgern für die Übergabe von fünf Schautafeln dankt.
Während Annaburg ein weißer Fleck in Benegals Film bleibt, sind die am Originalschauplatz nahe Kiel gedrehten Sequenzen über das Einschiffen des Netaji sehr beeindruckend, meint Vijay Hotani. Enttäuscht über sein Gespräch mit Hitler im Sommer 1942 - der Naziführer verweigerte erneut eine Unabhängigkeitsgarantie für Indien - bereitete Bose eine neue Phase seines Kampfes vor. Überstürzt verabschiedete er sich von seiner österreichischen Frau Emilie Schenkl und seiner zwei Monate alten Tochter Anita und bestieg am 8. Februar 1943 ein deutsches U-Boot in Richtung Indischer Ozean. Wenngleich Bose die autoritäre Führung und die technischen Leistungen im Dritten Reich bewunderte, hatte er große Vorbehalte gegenüber dem Rassismus der Nazis, kritisierte die abwertenden Indien-Aussagen in Hitlers »Mein Kampf« und ließ die Berliner Führung wissen, dass er den Überfall auf die Sowjetunion missbilligte. Geleitet von einem »bedingungslosen Nationalismus« ordnete er indes alle seine Handlungen der Befreiung seines Landes unter, für das er »eine sozialistische Republik Indien« mit Landreform und nationaler Planung anstrebte.
Auf Höhe Madagaskar von einem japanischen U-Boot übernommen, ging alles Schlag auf Schlag. Binnen weniger Monaten stellte Bose in Singapur mit Geldern der drei Millionen in Südostasien lebenden Inder die über 50 000 Mann starke Indische Nationalarmee (INA) auf und rief eine Provisorische Regierung aus. 8000 INA-Kämpfer nahmen auch an der japanischen Offensive gegen Ostindien teil. Am 14. April 1944 schien sich ihr Traum zu erfüllen: In Moirang im heutigen indischen Unionsstaat Manipur hissten sie die Fahne des freien Indien - heute kündet davon ein Memorial mit einer Statue Boses.
Absturz auf dem Weg in die Sowjetunion
Der Traum währte nur kurz. Die Briten bereiteten den Angreifern eine vernichtende Niederlage. Boses Hoffnung, die Ankunft seiner Truppen auf indischem Boden würde einen antikolonialen Aufstand auslösen, zerschlug sich. Am 17. August 1945 bestieg er als Verlierer, aber mit neuen Plänen, in Saigon ein Flugzeug, das ihn in die Mandschurei bringen sollte. Er wollte, so ist inzwischen mehrfach dokumentiert, in die Sowjetunion gehen, um neue Möglichkeiten für die Befreiung Indiens zu erkunden. Zuvor hatte er in seinen Rundfunkreden die Sowjetunion als kommende Weltmacht apostrophiert und vergeblich Kontakt zu Moskaus Botschafter in Tokio gesucht.
Doch kaum hatte die Maschine nach einer Zwischenlandung im damals japanisch besetzten Taiwan vom Rollfeld abgehoben, stürzte sie ab. Bose wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch am 18. August starb. Sein Tod kam vielen gelegen. Als die Briten im Dezember 1945 drei hohe INA-Offiziere - stellvertretend auch für die Annaburger Legionäre - in einem Schauprozess im Delhier Roten Fort wegen Hochverrats verurteilen wollten, erhob sich in ganz Indien ein Sturm der Empörung; die Offiziere mussten freigesprochen werden. Und den Briten wurde endgültig klar, dass ihr »Kronjuwel« verloren war. Zwei Jahre nach Boses Tod verkündete Nehru am 15. August 1947 von den Zinnen des Roten Forts die Unabhängigkeit Indiens.
Eine der letzten Szenen in Benegals Film zeigt, wie Boses Flugzeug gleichsam in die Unendlichkeit abhebt - Raum für vielerlei Gedanken.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.