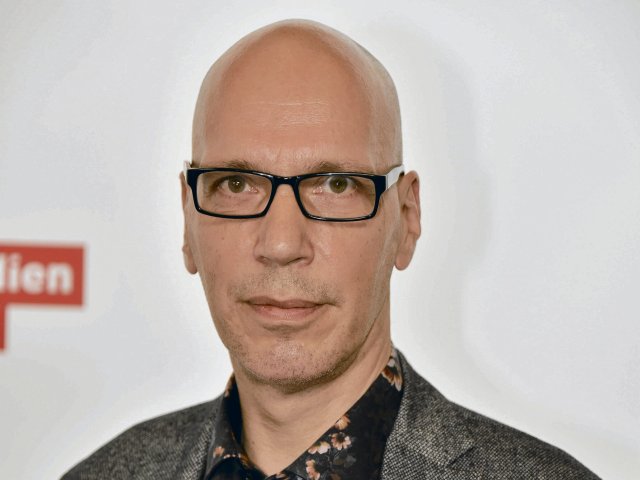- Politik
- Das Preisausschreiben der Akademie Dijon vor 250 Jahren
Eine senfscharfe Frage lässt Gelehrtenköpfe rauchen
Von Martin Teske
Die französische Stadt Dijon, einst Hauptstadt von Burgund, ist als Metropole des Senfs bekannt. Vor 250 Jahren hat die Akademie dieser Stadt der Wissenschaft eine brisante Würze verpasst mit der Preisaufgabe, ob die Erneuerung der Wissenschaften und Künste zur Veredlung der Sitten beigetragen habe. Gegen Ende des Jahres 1749 waren die Antworten abzugeben.
Die führenden Köpfe Frankreichs beginnen zu rauchen, allen voran Jean Jacques Rousseau. Gerade ihn, der in seiner Gefühlsphilosophie die Werte des Herzens über den Eigenwert der Vernunft stellt, trifft diese Frage wie ein Blitzstrahl. Rousseau stellt sich ganz bewusst gegen die aufklärerische Strömung seiner Zeit - und gewinnt mit seinem »Discours sur les sciences et les arts« den Preis. Seine Botschaft: Der Mensch ist mehr als nur der Kopf, da sind auch Empfindungen, Gefühle, Religiosität. Die eingegangenen unterschiedlichsten
Antworten auf die akademische Frage inspirieren eine Gesellschaft französischer Gelehrter, das Wissen der Welt zu einer »Enzyklopädie der Wissenschaften, Künste und Gewerbe« zusammenzutragen - ein durchaus aufklärerischer Ansatz. Als Herausgeber zeichnen der Mathematiker d'Alamert und der Philosoph und Literat Diderot. Als im Folgejahr 1750 der Prospekt über dieses Werk erscheint, finden sich zur ersten Auflage 4250 Subskribenten! Das Opus, das im Laufe der nächsten 30 Jahre auf 35 Folio- und zwei Registerbände anwachsen soll, erregt gewaltiges Aufsehen. Das große Reallexikon der Aufklärung verbreitet sich in Windeseile, denn es birgt höchst explosiven Stoff, sozusagen schärfsten Senf des Denkens. Die Autoren wissen das Kühnste zu sagen, untergraben alle alten Autoritäten und ecken natürlich mit der Kirche an. Zeitweise wird der Verkauf des Werkes verboten, in einigen deutschen Ländern ist schon der Besitz strafbar.
Dem Mathematiker d'Alambert als Initiator des gewaltigen lexikalischen Wurfes wird der Boden denn auch bald zu heiß. Er gibt den Stab im Staffellauf des Wissens
bald weiter an Denis Diderot, einen hellen Kopf, der seine Wissenschaft so sieht: Es gibt nur ein einziges großes Individuum, das Weltall. Das Gehirn, ja die ganze Welt ist ein sich selbst spielendes Klavier, und die Natur bedarf keines persönlichen Gottes, ebenso wenig wie der Mensch einer anderen Unsterblichkeit als des Fortlebens im Nachruhm. Im Gegensatz zu den Aufklärern - und hier ist er mit Rousseau einig - erklärt Diderot: Das Bewusstsein lässt sich nicht als blqßes Aggregat empfindungsfähiger Stoffteile erklären. Von diesem Standpunkt ruft er aus: »0 Gott, ich weiß nicht, ob du bist, aber ich will in meinen Gesinnungen und Taten so verfahren, als ob du mich denken und handeln sähest!« Den Kirchen allerdings ruft er zu: »Wollt ihr, dass der Mensch frei und glücklich sei, so mischt euch nicht in seine Geschäfte!« Der in Dogmen gefasste Glaube ist für ihn Quelle verderblicher Wirkungen.
Schärfer noch als Diderot hat der deutsche Baron Dietrich von Holbach, ebenfalls am großen Reallexikon des Denkens beteiligt, diese Gedanken formuliert: Auf Voltaire fußend, bezeichnet er die Religion
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.