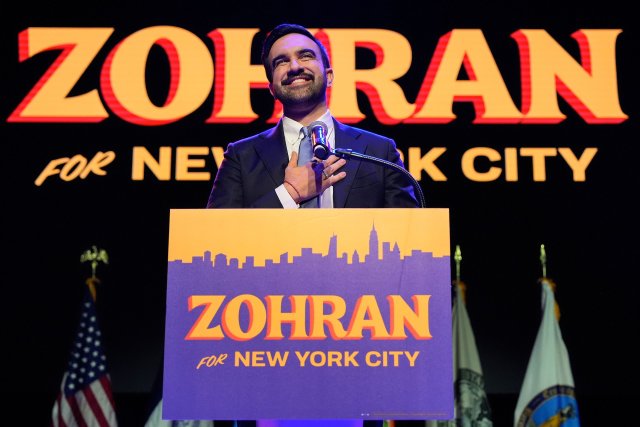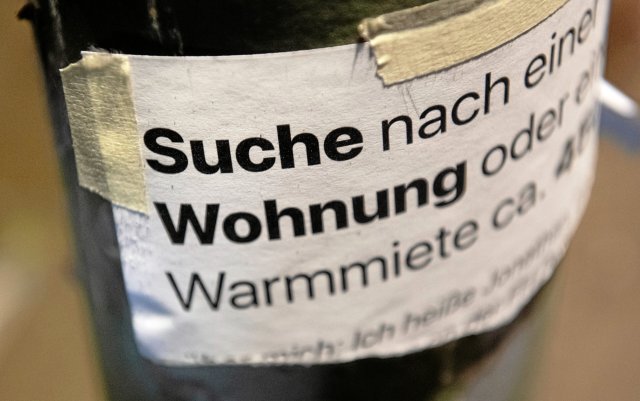- Politik
- Kampagne der Nazis gegen Junkers
Die Rache Görings
Am 27 Januar 1933 fand in Düsseldorf eine Konferenz einflußreicher Industrieller statt, auf der Hitler sein auf Krieg orientiertes Programm präsentierte und letzte Weichen in Bezug auf die Übergabe der Macht in Deutschland an die Nazis stellte. Drei Tage später wurde Hitler zum Reichskanzler ernannt. Kurz darauf begann der Terror gegen Kommunisten, Sozialdemokraten, demokratisch gesinnte Intellektuelle und Juden - und einen unliebsamen deutschen Unternehmer- Prof. Hugo Junkers, der den größten und modernsten deutschen Flugzeugwer ken mit Hauptsitz in Dessau vorstand.
Die Gründe, die ihn in Konflikt mit den Nazis geraten ließen, waren zweifelsohne vielfältiger Natur. Sie reichten von schnödem Konkurrenzdenken und Profitstreben über militärische Erwägungen bis hin zu handfesten persönlichen Aversionen. Mit der Konstruktion und Vermarktung von Flugzeugen wie der F 13 und der Ju 52/3m hatte Junkers der internationalen Zivilluftfahrt zu lichten Höhen verholfen. Er kannte sich aber auch in den «Niederungen» des Geschäftslebens aus und wußte alle Register zu ziehen, um Extraprofite zu realisieren und allzu forsche Kontrahenten auf Distanz zu halten. Was ihm nicht nur Freunde bescherte.
Vor allem die Reichswehr-Generalität nahm an seiner Geschäftspolitik Anstoß. Im Frühjahr 1932, nachdem auf Junkers' Drängen hin der Verbindungsmann zur Reichswehr, Gotthard Sachsenberg, aus der Leitung der Junkers-Werke entfernt worden war, versuchte das fliegertechnische Referat der Reichswehr eine Klage gegen ihn zu lancieren. Ihm wurde u. a. vorgeworfen, seine Flugzeuge nicht auf die Forderungen der Reichswehr abzustimmen und überhöhte Preise zu ver langen. Junkers war gewiss nicht gegen eine Beteiligung am Rüstungsgeschäft; er war jedoch partout nicht bereit, Militaristen ein Mitspracherecht in innerbetriebliche Belange einzuräumen und die ge- Anstellung als Werksflieger beworben - und eine Absage erhalten. Bereits am 2. Februar 1933 läutete Göring, der dem Reichskommissariat für Luftfahrt (ab 29 April 1933 Reichsluftfahrtministerium) vorstand, das Kesseltreiben gegen Junkers ein. Erhard Milch, Görings enger Vertrauter, forderte den Flugzeugkonstrukteur auf, alle auf seinen Namen eingetragenen lufttechnischen Patente auf seine Betriebe «Junkers Flugzeugwerk A.G.» und «Junkers Motorenbau GmbH» (die man dann konfiszieren wollte) zu überschreiben. Junkers weigerte sich. Milch wiederholte Anfang März 1933 diese Forderung und verlangte zudem die «fristlose Entfernung» von Junkers' engen Mitarbeitern Dr. Dethmann, Drömmer und Fernbrugg. Ende März ließ man die drei in «Schutzhaft» nehmen und unter sagte es Junkers, diese je wieder in seinen Werken zu beschäftigen. Unter diesem Druck erreichten die Nazis schließlich am 2. Juni, dass Junkers den Patentvertrag unterschrieb, woraufhin Milch am 22. August den Dessauer Junkers-Werken einen Auftrag zur Fertigung von 6235 Flugzeugen für die neue Luftwaffe gab.
Mit diesem Teilerfolg gaben sich Göring und Milch indes nicht zufrieden. Sie wollten Junkers, in ihren Augen ein suspekter Pazifist und Demokrat, endgültig kaltgestellt wissen. Mit ihrem noch im Juli 1933 favorisierten Ansinnen, ein Verfahren gegen Junkers wegen Landesverrat herbeizuführen, um so eine Handhabe zur Konfiszierung der Junkers-Werke zu bekommen, kamen sie jedoch nicht zum Zug. Milch forderte daher am 3. Oktober, dass Junkers die Aktienmajorität seiner Betriebe (51 Prozent) abzugeben habe. Am 17 Oktober wurden sämtliche Geschäftsakten der Junkers-Werke (mit Ausnahme der für den laufenden Verkehr benötigten) beschlagnahmt. Ferner ließ man Junkers in seinem Landhaus in Bayrischzell ver haften und ins Haus der Handelskammer nach Dessau bringen. Dort wurde er vor die Wahl gestellt, entweder einen bereits vorbereiteten Vertrag zur Übertragung der Aktienmajorität zu unterschreiben oder verhaftet und abgeurteilt zu werden. Nach nächtelanger «Bearbeitung» gab der 74-Jährige in der zweiten Stunde des 18. Oktober 1933 auf und unterschrieb den so genannten Nachtvertrag. Danach lebte er, aus Dessau verwiesen, unter verschärftem Hausarrest. Sein Fernsprechanschluß wurde gesperrt, ihm war jede Kontak taufnahme zu Werksangehörigen verboten.
Gedemütigt und beraubt verstarb Junkers am 3. Februar 1935, an seinem 76. Geburtstag, in Gauting bei München. Ihm blieb erspart, mitzuerleben, wie der gute Ruf, den Junkers-Flugzeuge in den 20er Jahren weltweit erlangt hatten, im Krieg kaputt gemacht wurde.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.