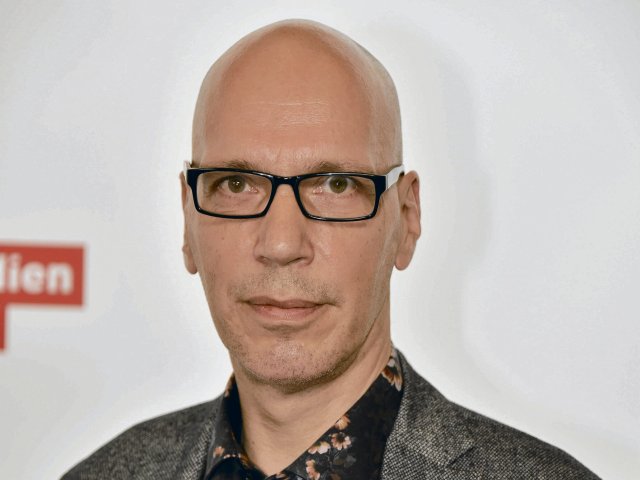- Politik
- Eine Ausstellung über den Dichter Peter Rühmkorf
Bleib erschütterbar und widersteh
Der Poet m seiner Klause. Ein großer Tisch, die Schreibmaschine zurück geschoben, das eingespannte Blatt zur Hälfte beschrieben. Teekanne und Tasse, eine Flasche, das gefüllte Rotweinglas, Papiere, Brillen, Stifte, ein wüstes Durcheinander. Hinten, durch die weit geöffnete Tür, kann man die Elbe sehen. Ir gendwo im Zimmer der Stuhl, an dessen Lehne ein Feldstecher baumelt. Im nächsten Bild hockt der Dichter schon draußen auf dem Brett des Dachfensters, eine Kaffeetasse in Reichweite, die Beine auf einem Geländer abgestützt, und blickt durchs Fernglas auf Wasser und Schiffe. Wenn er nicht auf der Maschine klappert oder liest oder Freunde empfängt, bezieht er mit Freuden seinen Beobachtungsposten und saugt süchtig die Welt ein. Es kann auch sein, dass er wieder mal auf dem Sessel thront und das aufgeschichtete Zeitungspapier unter sich mustert. Der ganze Fußboden stapelweise von alten Gazetten bedeckt. Soll er sie aufheben, lieber wegschaffen? Oder was macht man sonst mit diesem Zeug?
Zum Glück schmeißt Peter Rühmkorf selten was weg. Jedenfalls nichts Bedrucktes, wenn es später noch von Interesse sein kann, und Beschriebenes schon gar nicht. In seinem Archiv lagert so viel Zeit- so viel Literaturgeschichte, dass man nur staunen kann. Ein Bruchteil davon ist kürzlich in der Städtischen Galerie Erlangen ausgebreitet worden, leider nur zehn Tage lang, aber gottlob fanden sich für die Ausstellung noch andere Interessenten, und so kommt es, dass sie fünf Wochen lang erst einmal in der Berliner Akademie der Künste am Hanseatenweg gastiert (ehe sie ins schleswig-holsteinische Kloster Cismar, nach Tübingen und vielleicht auch nach München weiter zieht). Die Schau, so umfangreich, dass man sie nur gekürzt zeigen kann, ist mit Fotos, Briefen, Büchern, Manuskripten, Zeichnungen, den fantastischen «Kleck sographien», Plakaten und Zeitungen glänzend (und noch immer üppig) bestückt. Man sieht derlei nicht jeden Tag. Denn es ist ja nicht nur die Geschichte des Peter Rühmkorf, die hier dicht, anschaulich und faszinierend erzählt wird, sondern auch, in Teilen wenigstens, die Geschichte der frühen Bundesrepublik, gesehen aus der Perspektive der jungen und wilden Revoluzzer, die sich gegen Restauration und Reaktion heftig empörten.
Zur Eröffnung der Ausstellung hat Peter Rühmkorf sein Dachstübchen in Hamburg-Oevelgönne verlassen und ist, Manuskripte und Bücher in der Tasche, nach Berlin gekommen. Er sitzt zwischen Klaus Wagenbach und Friedrich Dieckmann auf der Bühne und berichtet, wie es war, als er zum ersten Mal eines dieser roten Flugblätter in der Hand hielt. Es war im November 1942, er war gerade dreizehn geworden, ein Pimpf wie alle anderen seines Alters auch, und vom Himmel regneten die Botschaften, die mit den Bombern kamen. Sie waren, sagt er, eine Offenbarung. «Novembertage» stand da und: «Rommels deutsch-italienische Panzerarmee wird bei El Alamein in die Flucht geschlagen.» Er erfuhr, dass bei Stalingrad die russische Winter offensive begonnen hatte. Und sah dieses Deutschland plötzlich aus ganz anderer Perspektive. Er las Dinge, die er gar nicht kennen durfte, blickte in ein Gesicht, das einem Mann namens Martin Niemöller gehörte. Es war lebensgefähr lieh, die Blätter aufzuheben. Aber er hat sich, vielleicht weil er einfach zu jung war, nicht darum geschert. Nach jedem Bombenangriffzog er auf die Felder, um einzusammeln, was da herumlag. Dann trug er die Beute nach Hause und versteckte sie. Ein paar dieser Flugblätter mit «Nachrichten für die Truppe» hängen nun in der Ausstellung. Seltene Dokumente auch in den nächsten Abteilungen: ein Exemplar der hektografierten Monatsschrift «Zwischen den Kriegen», die Rühmkorf mit seinem früh verstorbenen Freund Werner Riegel herausgab, oder der «Studentenkurier» des Klaus Röhl (aus dem 1957 «konkret» hervorging). Rühmkorf schrieb sich beinahe die Finger wund für diese Postille. Er wusste nicht, dass das Blatt von der DDR bezahlt wurde. Er bekam keinen Pfennig für seine Arbeit und gönnte sich dafür den Luxus, die eigene radikalsozialistische Meinung unverblümt in die Welt zu setzen, und manchmal, sagt er heute, geschah s sogar, dass sich seine privaten Ansichten mit den offiziellen Verlautbarungen der DDR deckten. So verrückt ging's zu in jenen Tagen.
Rühmkorf verehrte Benn und liebte die Barrikade. Einer seiner Sprüche, bald ein geflügeltes Wort, lautete: «Bleib erschütterbar und widersteh». Er kämpfte mit wechselnden Pseudonymen gegen die schlechte Luft, die aus Bonner Regierungsvierteln kam, und gegen die tonangebenden Geister von gestern. Er schlachtete als Leslie Meier die Lyriker, die sich ins Unverbindliche zurückzogen, und stand auf Podien, wo man dem Frieden das Wort redete. Er fuhr nach Warschau zu den Weltfestspielen, nach Prag und nach China, er war ständig auf Achse, und zwischendurch hämmerte er zornige Ar tikel und bissige Gedichte in die Maschine.
Natürlich hat man ihn beschimpft und nach Herzenslust verrissen. Aber es gab auch immer wieder Ermutigung. Unter den eng beschriebenen Postkarten, die ihm Arno Schmidt aus Bargfeld schickte und die hier erstmals zu sehen sind, ist eine vom September 1960. Sie beschwört ihn, bloß nicht die Flinte ins Korn zu wer fen: «Nehmen Sie sich ja nicht die Scheiß- Kritiken so zu Herzen. Mischen Sie sich ja nur wieder in die Rudel der Besten der Nation .... Sie ärgern die Kerls allealle, ob Regierung ob Journaille, viel mehr, wenn Sie schreiben, als wenn Sie schweigen.»
Rühmkorfs Werk, beinah unüberschaubar, hat man auf mehrere Vitrinen verteilt. Liebeslyrik, politische Pamphlete, Mär chen, Tagebücher. Frühe Ausgaben wie die Wolfgang-Borchert-Monografie, die er in wenigen Wochen für Rowohlt geschrieben hat und die in vierzig Jahren, immer wieder neu aufgelegt, nicht alt geworden ist. Bücher, die Horst Janssen, der Freund, in ein unverwechselbares Kleid gesteckt hat. Dünne, vergilbte Broschüren, der ex quisit ausgestattete Band «VON MIR ZU EUCH FÜR UNS» von 1999 den Rowohlt nicht drucken mochte und den Steidl inzwischen fünftausendmal verkauft hat. Das Tagebuch «Tabu I» und die ersten beiden Bände der Werkausgabe. Nur zwei dieser Bücher kamen aus der DDR, die Gedichtsammlung «Phönix voran!», 1982 in der weißen Lyrikreihe bei Volk und Welt erschienen, und das Reclam-Bändchen «Dintemann und Schindemann» von 1985, eine Auswahl der «aufgeklärten Märchen». Immerhin hat man Rühmkorf 1988 den Heinrich-Heine-Preis verliehen. Die Urkunde liegt gleich neben der Begründung, mit der ihm 1993 der Georg- Büchner-Preis übergeben wurde.
Am Schluss der Ausstellungseröffnung geht der 71-jährige Poet noch einmal ans Pult, blättert im Band mit den «vorletzten Gedichten» (die so überschrieben sind wie diese Exposition: «wenn - aber dann») und liest ein paar Texte. Die Verse sind leiser geworden, verhaltener, herbstlicher. Sie heißen «Altern als Problem für Künstler», «Abschiede, leicht gemacht» oder «Gesegneter Abgang». Freilich: Die Eleganz und Leichtigkeit, den Witz und die Ironie haben sie nicht verloren. Hier, in diesem Band, steht auch der Wunsch, den er für «die Tage nach Ladenschluss» hat: «Nein, keinen Ordensstern, keine Ehrenschleppe, / aber daß ihr vielleicht in die unterste Stufe / der Ringeinatztreppe / meinen Namen einkerbt.»
Bis 25. Februar in der Akademie der Künste, Hanseatenweg 10 Mo 13-19 Di-So 10-19 Uhn Eintritt 8 DM, erm. 5 DM, mittwochs Eintritt frei.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.