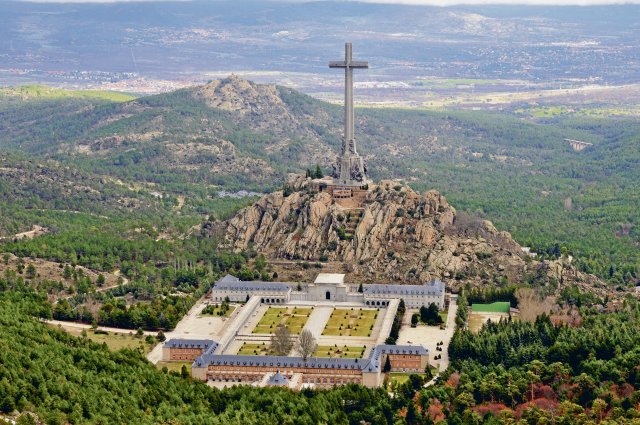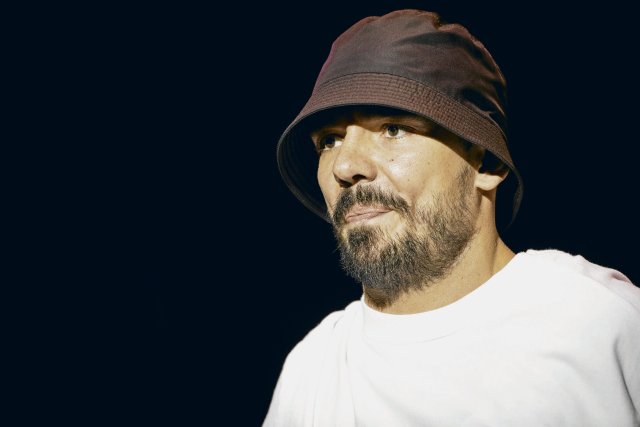- Politik
- Finanzielles Fazit der Fußball-WM
Deutschlands teuerste Imagekampagne
Die Steuerzahler blechen, private Firmen kassieren ab / Bund, Länder und Kommunen lassen sich trotz leerer Kassen die WM-Spiele Milliarden Euro kosten
Dabei wird die Liste der staatlichen Subventionen lang und länger. Dortmund startete eine »Charmeoffensive«, um das Ruhrgebiet während der WM als attraktiven Standort zu feiern. In den Spielorten flossen viele Extra-Millionen ins Stadtmarketing, trotz der Gefahr einer gegenseitigen »Kannibalisierung«. 100 Millionen steuerte München allein für die Infrastruktur rund um die neue »Allianz Arena« bei, wovon vor allem die private Fußballfirma Bayern München AG profitieren wird. Obendrein finanziert die Stadt das Internationale Medienzentrum für die FIFA. Für 20 Millionen bauten Hamburgs Behörden selten befahrene Autobahnanschlüsse um und besserten Parkplätze aus, 146 Millionen hat Leipzig in seinen WM-Aufbau-Ost gesteckt.
Teuer kommt den Steuerzahler auch der grüne Rasen. Die Fußball-WM 1974 in Deutschland kostete für neun Stadien rund 250 Millionen Mark. Dieses Mal wurde in Bau und Erweiterung der zwölf Spielstätten, davon bekanntlich nur eine in den neuen Bundesländern, rund 1,38 Milliarden Euro investiert; 570 Millionen davon bezahlte die öffentliche Hand. Keine Selbstverständlichkeit, denn private Kapitalgeber scheuen Stadion-investitionen, da sie »mit hohen Risiken« verbunden sind, wie bereits im Jahr 2000 in einer Studie für den Bankenverband gewarnt wurde. Stadien, selbst wenn sie mit dem Attribut »multifunktional« versehen sind, rentierten sich nur in Verbindung mit erfolgreichem Profifußball; bekanntlich kann aber nur ein Klub Bundesliga-Meister werden. Zur No-Go-Area dürfte daher nach der WM der Nachfolger des Leipziger Zentralstadions verkommen - der beste ortsansässige Traditionsverein, Sachsen Leipzig, kickt in der vierten Liga.
Die großzügige Steilvorlage der öffentlichen Hand erreicht jedoch die meist privatwirtschaftlichen Betreiber der modernen Volksarenen und die dort spielenden Fußballfirmen. Dieses bedeutet einen erheblichen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Klub-Konkurrenz ohne WM-Subvention.
Freude herrscht vor allem auch beim WM-Veranstalter FIFA, der dank Staatshilfe und tausender Freiwilliger 1,5 Milliarden Euro Gewinn einspielt. Teuer wird es dagegen für die Steuerzahler. Die Bundesregierung beziffert ihre Ausgaben allein für die Verkehrsinfrastruktur auf 3,7 Milliarden Euro; davon wurde aber ein Teil, wie der neue Berliner Hauptbahnhof und die vierte Elbtunnelröhre in Hamburg, für die WM lediglich zeitlich vorgezogen. Dazu kommen 250 Millionen Euro für den Ausbau der Stadien in Berlin und Leipzig, 29 Millionen Euro für das Kunst- und Kulturprogramm aus dem Silbermünzerlös, zehn Millionen Euro für die Standortkampagne »Land der Ideen« und drei Millionen Euro für die Service- und Freundlichkeitskampagne, teilt das federführende Bundesinnenministerium auf ND-Anfrage mit. Dies ist aber noch lange nicht alles: »Nicht quantifizierbar« seien die Sicherheitsmaßnahmen von Bund und Ländern, ergänzt das Ministerium. »Um das Gastgeberland bestmöglich zu präsentieren«, wirken die Ressorts der Regierung außerdem bei Akkreditierung, Journalistenbetreuung, Umweltschutz, Protokoll, Briefmarken, Gesundheit, Tourismus, Verbraucher- und Markenschutz, Logistik, Sportwissenschaft, Kulturprogramm sowie Schul- und Jugendkampagnen mit.
Hinzu kommen zahlreiche Investitionen der Länder und Kommunen, die sonst gerne laut über ihre Finanzflaute klagen. Allein die zwölf Austragungsstädte haben insgesamt »rund 1,2 Milliarden Euro« ausgegeben, so die Arbeitsgemeinschaft der WM-Städte. Erhebliche Kosten leisteten sich auch die meist kleineren Kommunen, in denen die Teilnehmerländer ihre Quartiere aufschlugen - etwa für WM-reife Trainingsrasen, in denen unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainiert wurde. Im badischen Bühl sollen die englischen Fahnen aber lange vor dem Ausscheiden wieder eingerollt worden sein, da sich kein Beckham blicken ließ.
Alles in allem müssen die Steuerzahler um die sechs Milliarden Euro für die Fußballweltmeisterschaft aufbieten. Von den Ausgaben wird nur jeder zehnte Euro wieder in den Staatssäckel zurückgespielt werden, teilt die Bundesregierung mit. Auch die Volkswirtschaft profitiert kaum von der WM. Und so lässt sich bestenfalls sagen: Deutschland hat Milliarden in die größte staatliche Imagekampagne aller Zeiten gesteckt.
Gewinner FIFA
Auch wenn es noch drei WM-Spiele gibt, lässt sich schon jetzt sagen: Finanzieller Verlierer der WM ist der Steuerzahler, Sieger ist der Weltfußballverband FIFA. Die Einnahmen aus dem Kartenverkauf decken die Ausgaben von 430 Millionen Euro für die Organisation der WM-Spiele. Die anderen Einnahmen aus der WM werden auf den Züricher Sonnenberg überwiesen, auf dem die FIFA in postmodernem Ambiente residiert. 960 Millionen Euro bringen allein die Fernsehrechte ein. Dazu kommen die Gelder der 21 exklusiven Sponsoren, die zwischen 12,9 Millionen (national) und 70 Millionen (international) berappen. Die WM-Bilanz der FIFA: Kosten von etwa 500 Millionen stehen Einnahmen von zwei Milliarden Euro gegenüber; der Reingewinn beträgt rund 1,5 Milliarden Euro.
hape
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.