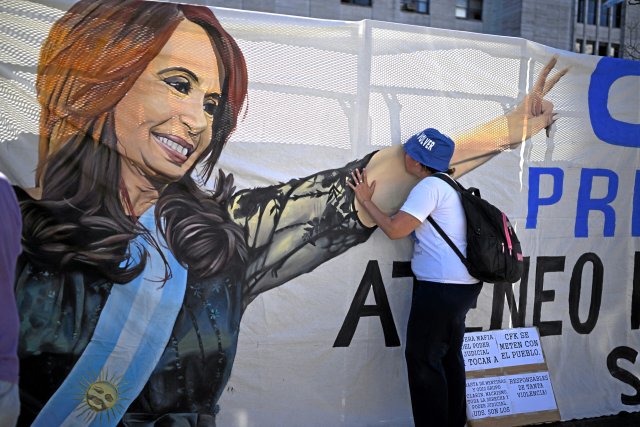»Gute Arbeit braucht klare Regeln«
Klaus Pickshaus über die Initiative »Gute Arbeit« der IG Metall und den finanzmarktgetriebenen Kapitalismus
nd: Im Jahr 2002 startete die IG Metall mit dem Projekt »Gute Arbeit« nach langer Zeit wieder eine Initiative zur Humanisierung der Arbeit. Der Untertitel Ihrer gerade erschienenen Bilanz dieser Zeit heißt »Gute Arbeit und Kapitalismuskritik«. Wie viel Kapitalismuskritik steckt denn in dem Projekt?
Pickshaus: Viel, denn sie beruht auf einer Analyse des finanzmarktgetriebenen Kapitalismus und seinen Auswüchsen. Der Grund für die Initiative waren Forderungen aus unseren Interessenvertretungen, gewerkschaftliche Antworten auf Phänomene wie permanente Leistungsverdichtung und gesundheitsschädigende Arbeitsbedingungen zu finden. Um diese Antworten geben zu können, mussten wir wissen, womit wir es zu tun haben.
Arbeitspolitik, also der Versuch, die Bedingungen der Arbeit zu regulieren, wurde in den Gewerkschaften lange Zeit randständig behandelt. Der letzte große Versuch stammt aus den 1970er und 1980er Jahren und war vor allem auf die Industriearbeit ausgerichtet. Was sind die neuen Herausforderungen?
Die alten Projekte zur »Humanisierung der Arbeit« waren eine Antwort auf die Zumutungen des fordistischen Kapitalismus, es ging um Fragen wie Taktzeiten oder die Zerstückelung der Arbeit. Im postfordistischen Kapitalismus sind Themen wie Entgrenzung und Prekarisierung der Arbeit zentral. Das hängt mit der Maßlosigkeit dieser Ökonomie zusammen, die sich an den Maßgaben des Shareholder Value orientiert. Druck auf die Beschäftigten wird nicht mehr in erster Linie durch den Vorgesetzten ausgeübt, sondern durch den Markt. Viele Beschäftigte internalisieren das unternehmerische Denken oder nehmen es als alternativlos hin. Das führt zu einem Arbeiten ohne Ende.
Die IG Metall fordert eine Anti-Stress-Verordnung. Ist das nicht zu wenig?
Verbindliche Regeln, um der gesundheitsschädigenden Arbeitsverdichtung wirksamer zu begegnen, sind unabdingbar. Dazu kann eine Anti-Stress-Verordnung beitragen. Diese ist überfällig, denn auch der Bundesrat hat dies vor einem Jahr beschlossen. Jetzt muss die Regierung handeln. »Gute Arbeit« braucht klare Regeln. Aber ein Erfolg in der betrieblichen Praxis verlangt auch, dass die Beschäftigten sich selbst die Grenzen deutlich machen.
Vor zehn Jahren konnten die Wenigsten etwas mit der Forderung nach »Guter Arbeit« anfangen, heute kommt nicht einmal die SPD ohne sie aus. Muss die IG Metall aufpassen, dass »Gute Arbeit« irgendwann nicht auf Work-Life-Balance für Manager reduziert wird?
Das ist das Dilemma eines erfolgreichen Agendasettings. Sobald das Thema eine breitere gesellschaftliche Resonanz bekommt, wird es von anderen Akteuren aufgegriffen. Und dann möglicherweise auch mit entgegengesetzten Inhalten gefüllt.
Wie gehen Sie damit um?
Wir machen unsere eigenen Positionen deutlich, etwa mit dem »DGB-Index Gute Arbeit«, einer jährlich durchgeführten repräsentativen Beschäftigtenbefragung zur Beurteilung der Arbeit. Da wird deutlich, dass wir Antworten auf zunehmende Leistungsüberforderung und Prekarisierung brauchen. Antworten, die die Politik momentan nicht gibt.
Die alte Kampagne erschien offensiver, sie war etwa mit der Forderung nach einer Demokratisierung der Fabrikarbeit verbunden ...
Sie war unter spezifischen Bedingungen möglich. Es war keine große Bewegung von unten. Auch wenn etwa 1973 ein erster Tarifvertrag mit Humanisierungselementen im Streik durchgesetzt werden konnte. Es gab eine sozialliberale Koalition mit einem Forschungsminister, der aus der IG Metall kam. Hans Matthöfer hat dazu beigetragen, dass einzelne Unternehmen gute Projekte etwa über qualifizierte Gruppenarbeit durchführten. Das hatte aber nie eine Flächenwirkung. Auch heute kann »Gute Arbeit« nur demokratische Arbeit sein.
Klaus Pickshaus: Rücksichtslos gegen Gesundheit und Leben. Gute Arbeit und Kapitalismuskritik - ein politisches Projekt auf dem Prüfstand. VSA Verlag Hamburg, 176 S., 14,80 €.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.