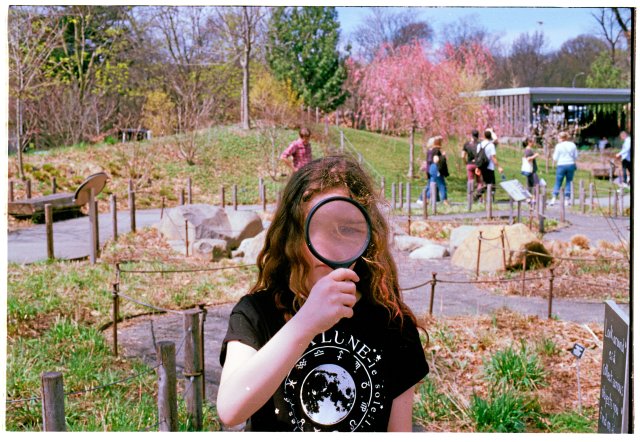Arbeiten Menschen grundsätzlich lieber vertrauensvoll mit anderen zusammen oder streben sie ihre Ziele eher rücksichtslos an? In seinem neuen Buch, das Mitte September erscheint, vertritt der Freiburger Mediziner und Psychotherapeut Joachim Bauer eindeutig die erste These - auch wenn Krieg, Gewalt und Ausbeutung auf der Welt eine andere Sprache zu sprechen scheinen.
Zum Schicksal von Rhesusaffen gehört es, dass sie beliebte Versuchstiere sind. Im vergangenen Jahr haben sie auch Dario Maestripieri von der Universität Chicago zu einer denkwürdigen Studie verholfen.
Der aus Italien stammende Psychobiologe wollte herausfinden, ob frühe Erfahrungen oder die Erbanlagen darüber entscheiden, ob aus Rhesusäffchen fürsorgliche Affenmütter werden - oder solche, die ihren Nachwuchs misshandeln. Dazu nahm der Verhaltensforscher einem Teil der Äffinnen, die sich entweder als fürsorglich oder als gewalttätig erwiesen hatten, ihre Affenbabys weg und gab sie in die Hände von Müttern aus der jeweils anderen Gruppe.
Und siehe da: Sämtliche Muttertiere, die als Säuglinge bei fürsorglichen Müttern gelebt hatten, kümmerten sich um ihren eigenen Nachwuchs liebevoll. Überraschender noch: Die Äffinnen verhielten sich auch dann fürsorglich, wenn sie selber von gewalttätigen Müttern stammten. Umgekehrt wurden 50 bis 60 Prozent auch jener Affenfrauen zu gewalttätigen Erzieherinnen, die zwar von liebevollen Müttern geboren, dann aber sofort zu Versuchszwecken in die Obhut liebloser Affenmütter gegeben worden waren.
»Wenn es um Verhalten geht, haben biografische Erfahrungen - vor allem solche in der Lernphase des Lebens - offensichtlich eine stärkere Wirkung als die genetische Abstammung.« So urteilt - nicht nur mit Blick auf diese Studie - der Freiburger Psychiater und Internist Professor Joachim Bauer. Der Leiter der psychosomatischen Ambulanz an der Uniklinik Freiburg hat den Affen-Versuch mit Bedacht in seinem neuen Buch aufgeführt, dessen Titel nach Ansicht des Autors Programm sein sollte - für die Erziehung, die Schule und die Arbeitswelt. Er lautet: »Prinzip Menschlichkeit - Warum wir von Natur aus kooperieren.«
Der womöglich auf den Menschen übertragbare Rhesusaffen-Versuch dient Bauer nur als Mosaik-Stein, um die wesentliche These seines Buchs zu belegen: Er beschreibt den Menschen als »Wesen, dessen zentrale Motivationen auf Zuwendung und gelingende mitmenschliche Beziehungen gerichtet sind.«
Natürlich weiß auch der Experte für das Zusammenspiel von Körper und Seele, dass nicht wenige Zeitgenossen den Menschen ganz anders sehen - nicht nur beim Anschauen der Nachrichten-Sendungen mit ihrer traurigen Kunde von Gewalt, Krieg und flammender Konkurrenz. Bauer zufolge hängen Menschenbilder »zu einem nicht geringen Teil« mit den Erfahrungen zusammen, »die wir mit anderen - vielleicht auch mit uns selbst - gemacht haben«. Fest verankert in vielen Köpfen ist auch heute noch der auf Charles Darwin zurückgehende Begriff des »Kampfes ums Dasein«. Tatsächlich nahm der maßgebliche Begründer der Evolutionstheorie in seinem 1895 veröffentlichten Buch »Vom Ursprung der Arten« an, es könnten sich nur solche vererbbaren Eigenschaften durchsetzen, die im vermuteten Dauerkampf ums Überleben vor Vorteil seien. Vom »Krieg der Natur« sprach Darwin - mit immensem Wiederhall gerade in Deutschland, wo später die Nationalsozialisten ihre unsägliche Rassen-Theorie mit Darwins verquerem Natur-Bild begründeten.
Dabei steht Darwins Abstammungslehre auch für Joachim Bauer »außer Frage«. Doch der Mediziner wendet sich gegen die seiner Ansicht nach irrigen Vorstellungen der Soziobiologe, etwa jene von »egoistischen Genen«. Nichts hält er deshalb auch vom Sozial-Darwinismus, nach dem das alltägliche Leben ein Konkurrenzkampf Stärkerer gegen Schwächere sein müsse, weil die Erbanlagen dies so wollten.
Für Bauer gilt vielmehr: »Kern aller menschlichen Motivation ist es, zwischenmenschliche Anerkennung, Wertschätzung, Zuwendung oder Zuneigung zu finden und zu geben.« Daran würden Menschen auch nicht von ungünstigen Genen gehindert, die sie angeblich zu Kampfmaschinen machen. »Gene sind weder Diktatoren noch autistische Eigenbrötler«, schreibt Bauer, der auch als Neurobiologie geforscht hat. »Gene empfangen Signale und reagieren auf sie, kommunizieren also mit der Umwelt. Sie steuern nicht nur, sie werden auch gesteuert.« Erfahrungen und Außenreize drücken gewissermaßen auf Gen-Schalter, oder sie tun es eben nicht - ähnlich einem Piano, das schweigt, solange keiner seine Tasten drückt..
Hinzu kommt für Bauer, dass Säugetiere dazu neigen, »Erfahrungen, die sie in der frühen Lernphase ihres Lebens am eigenen Leibe gemacht haben, später an ihre eigenen Nachkommen weiterzugeben«. Dies sei auch beim Menschen zu beobachten. »Wir müssen uns daher mehr als bisher klar machen, dass es - neben der klassischen Vererbung - eine davon unabhängige Weitergabe von biologischen und psychologischen Merkmalen von einer Generation zur nächsten gibt«, mahnt der Autor an - und verweist auf weitreichende Konsequenzen gerade für die Früherziehung von Kindern.
Denn überschrieben werden können ungute Erfahrungen und ungünstige Verhaltensmuster aus den ersten Lebensjahren später nur begrenzt und mühsam - etwa in einer Therapie. Am ehesten gelingt es noch in der Pubertät - zumindest legen das Versuche mit Nagetieren nahe. »Voraussetzung ist allerdings, dass die Pubertierenden in dieser Zeit tatsächlich neue, bereichernde Erfahrungen machen können«, fügt er hinzu.
Falls es sich beim Menschen so verhält wie bei Nagern, wogegen Bauer zufolge »nichts spricht«, müsse es umso mehr beunruhigen, »dass unsere Gesellschaft einem Teil der Jugendlichen derzeit nichts als soziale Vernachlässigung, Gewalt verherrlichende Bildschirmprodukte, Lehrstellenmangel und Arbeitslosigkeit anzubieten hat«. Längst leiden Expertenschätzungen zufolge in Deutschland etwa 2,5 Prozent der Kinder und 8 Prozent der Jugendlichen an Depressionen.
Wegen dieser Zeitbombe mahnt Bauer: »Gesellschaften, die es zunehmend für verzichtbar halten, dass Kinder und Jugendliche verlässliche Bezugspersonen haben, die ihnen Zeit und Zuwendung schenken und die keinen Anstoß daran nehmen, dass junge Leute privat und beruflich zunehmend entwurzelt leben, werden dafür einen hohen Preis bezahlen.«
Ein Kind könne »nur dann ein individuelles, autonomes Selbst entwickeln, wenn es konstante, liebevolle Bezugspersonen hat, die es in seiner Besonderheit wahrnehmen und ihm seine Individualität spiegeln«. Doch insbesondere die Väter machten sich oft rar. Das findet Bauer schon deshalb schade, weil seine schönste kooperative Erfahrung bisher »der langsame, über Jahre gehende Aufbau einer persönlichen Bindung mit meinen beiden inzwischen erwachsenen Kindern« gewesen ist. Väter ernteten durch die persönliche Fürsorge für ihr Kind einen »Zuwachs an Menschlichkeit«.
Joachim Bauer: Prinzip Menschlichkeit - Warum wir von Natur aus kooperieren. Hoffmann und Campe, 256 S., geb., 19,95 EUR, erscheint Mitte September