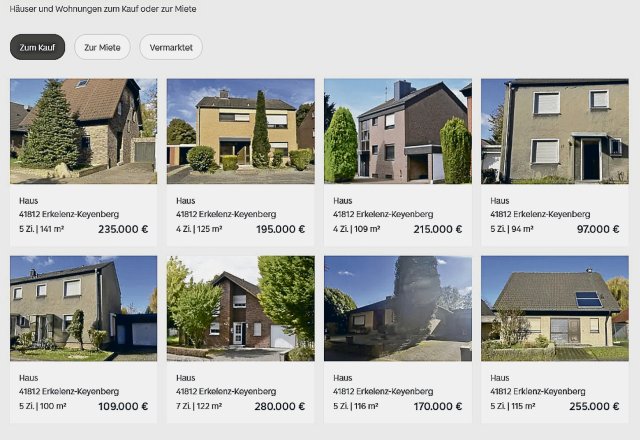Abschiebung in das sichere Kriegsgebiet
Mehrere Hundert Menschen demonstrierten auf dem Frankfurter Flughafen gegen die Sammelabschiebung von 50 Geflüchteten nach Afghanistan
Jaganath Gardezi war völlig aufgelöst. Der Vorsitzende des Vereins afghanischer Hindus in Frankfurt stand am Mittwochabend in der Eingangshalle des Flughafens und ließ seinem Ärger freien Lauf. »Ich lebe seit 31 Jahren in Deutschland. Und ich habe noch nie erlebt, dass kurz vor Weihnachten so eine Sammelabschiebung durchgeführt wird«, schimpfte er in die zahlreichen Mikrofone und Fernsehkameras und fügte verzweifelt hinzu: »Ich will, dass diese Abschiebung heute gestoppt wird. Aber diese Forderung interessiert die Bundesregierung ja nicht.«
Es gehörte wohl zur Ironie des Schicksals, dass sich Gardezi in diesem Moment direkt unter der großen Tafel befand, auf der immer die nächsten Flüge angezeigt werden. Denn er wollte gar nicht fliegen, sondern vielmehr gegen einen Flug protestieren, der überhaupt nicht auf der Tafel stand: gegen die Sammelabschiebung von 50 Geflüchteten nach Afghanistan. Ins Kriegsgebiet. Mit Gardezi hatten sich mehrere Hundert Menschen auf dem Flughafen versammelt, um ihren Unmut über diese Abschiebung auszudrücken.
Anschließend bewegte sich der Demonstrationszug durch das Flughafengebäude, vorbei an Schmuckgeschäften und Zeitungsläden, an Flugbegleitern und Fluggästen in chicen Anzügen. Ein Ladenverkäufer zückte sein Handy, filmte die Demo. Man spürte: Die Protestierenden erregten Aufmerksamkeit, weil sie nicht so ganz in das normale Flughafenleben zu passen schienen, weil sie Routinen durcheinander brachten. Auch wenn sie den Flug, der nach Informationen des »Hessischen Rundfunks« um 18:40 Uhr in Richtung Kabul abheben sollte, nicht verhindern konnten.
So pendelte die Stimmung unter den Demonstranten im Sekundentakt zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Sie klatschten und johlten, wenn einer durchs Mikrofon forderte, dass »alle bleiben sollen«. Gleichzeitig waren sie spürbar entsetzt. Vor allem Hindus waren gekommen, sie hielten Schilder hoch und den Protest auf ihrer Handykamera fest. So sendeten sie eine Botschaft in die Welt. Und vor allem: an Bundesinnenminister Thomas de Maiziere, der solche Abschiebungen nach Afghanistan seit Monaten forderte, nachdem die Bundesregierung einige afghanische Großstädte wie Kabul, Masar-i-Scharif und Herat als sicher eingestuft hatte.
Ein bestimmter Name war auf den Schildern besonders häufig zu lesen, stellvertretend für alle anderen: Samir Narang. Etwa vier Jahre lang lebte der Hindu in Hamburg, bekam immer wieder eine Duldung. Nun war er einer der ersten, die zurück in die zerbombte Heimat gebracht wurden. »Ich habe Todesangst – und das Gefühl, es ist alles ein böser Traum«, hatte Narang noch am Dienstag gesagt. Nun geriet der böse Traum zur bitteren Realität. »Samirs Mutter ist heute hier, sie ist vorhin zusammengebrochen«, sagte Jaganath Gardezi und flehte: »Wenn wir die Abschiebung schon nicht verhindern können, dann soll sie wenigstens noch einmal ihren Sohn sehen und ihm 'Tschüss!' sagen, bevor er in den Tod fliegt.« Allein: Der Wunsch wurde ihr nicht gewährt.
Zahlreiche deutsche Unterstützter sowie die LINKE hatten sich den Protesten angeschlossen. »Die Bundesregierung sieht, dass sie ihre Entscheidungen nicht ohne Gegenwehr durchbringen kann«, sagte Achim Kessler, Pressesprecher der hessischen LINKEN, und fügte an: »Ich hoffe, dass in Zukunft noch mehr Menschen zu diesen Demos kommen.« Denn auch Kessler wusste, dass diese Sammelabschiebung wohl nicht die letzte sein wird.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.